-
-
Diese
Seite entstand in Zusammenarbeit mit Norbert Scholz.
-
Quellenangaben:
/1/ Anonym: Das
Buch im Spiegel seiner Zeit. 90 Jahre A. Weichert Verlag
Hannover-Berlin. 1872-1962. Hannover 1962; CF /5729/; Das
Bild von August Weichert ist von Walter Kellermann (von mir
nachbearbeitet)
/2/ Kosch, G. und
Nagl, M: Der Kolportageroman. Bibliographie 1850 bis 1960 (Repertorien
zur Deutschen Literaturgeschichte 17). Stuttgart / Weimar 1993
/3/ Galle, Heinz
J.: Verlag August Weichert, Hannover-Berlin. In:
Schegk, Wimmer (Hrsg.), Lexikon der Reise- und Abenteuerliteratur, Teil
4: Verlage, 8. Erg.-Lfg. Dezember 1990, S. 1-18
/4/ Zitat aus der Zeitschrift Deutscher
Buch- und Steindrucker, aus /17 Zitat von Seite 7
/5/
Rühle, Reiner: Böse Kinder : Kommentierte Bibliographie von
Struwwelpetriaden und Max-und-Moritziaden mit biographischen Daten zu
Verfassern und Illustratoren; Bibliographien des Antiquariats
H. Th. Wenner 4, Osnabrück 1999, S. 41
/6/ Brandenberg, Verena: Rechtliche
und wirtschaftliche Aspekte des Verlegens von Schulbüchern
in:Hrsg. Rautenberg und Titel: ALLES BUCH - Studien der
Erlanger Buchwissenschaft 18, 2006, ISBN 3-9809664-8-8, Seite
25
/7/
Verlagsnachrichten vom 29.4.2002 auf www.buchmarkt.de
/8/ Galle, Heinz J.: Volksbücher und
Heftromane Band 3: Die Zeit von 1855 bis 1905 – Moritatensänger,
Kolporteure und Frauenromane. Lüneburg 2006
/9/ Thadewald,
Wolfgang: [Werkverzeichnisse.] Verne, Jules. Bibliographie,
in: Schegk, Wimmer (Hrsg.), Lexikon der Reise- und Abenteuerliteratur,
Teil 1: Autoren, Meitingen 1988ff. 42. Erg.-Lfg. März 1999, S. 1-46;
43. Erg.-Lfg. Juli 1999, S. 47-92; 44. Erg.-Lfg. Nov. 1999, S. 139-182
/10/ Hinrichs'
Funfjahrs-Katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher,
Zeitschriften, Landkarten; Band 9, Teil 1, Leipzig 1896,
Seite 623
Zur Person:
August
Weichert
(1854 - 1904)
Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne
empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.
-
-
|
Verlagsgeschichte
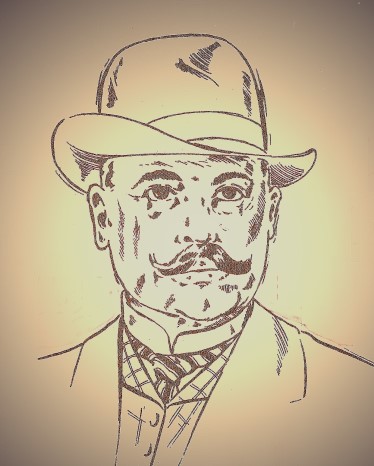 August
Weichert (14. April 1854 bis 25. Okt. 1904, Bild links /1/) kam als
junger Mann nach Berlin in einer Zeit, die uns heute durch den
damaligen wirtschaftlichen Aufschwung als Gründerzeit bekannt ist. Er
begann seine Verlagsarbeit am 1. Oktober 1872 in der Barnimstr. 48, im
Berliner Nordosten. Zwar beendete die Weltwirtschaftskrise 1873 kurz
nach Verlagsgründung diese Phase der industriellen Hochkonjunktur, aber
insgesamt gesehen brachte die Zeit vor der Jahrhundertwende bis zum
Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 eine anhaltenden Steigerung des
Wohlstandes. An diesem hatten auch die breiten Massen, wenn auch im
bescheidenen Umfang, teil. Zu dem „Luxus“, den man sich gönnte, gehörte
auch der Kauf von Literaturerzeugnissen. Genau das hatte Weichert
erkannt. Er war angetreten, um mit preiswerter Literatur die
Lesebedürfnisse der einfachen Leute zu befriedigen, waren doch bis dato
die Buchproduktionen der renommierten Verlage dem zahlungskräftigen
Bürgertum vorbehalten. In den Anfangsjahren war er spezialisiert auf
den Vertrieb von Kolportageromanen, eine Literaturgattung, die ihren
Erfolg dem sozialen Wandel in den neuen städtischen Ballungszentren
verdankte. Ihr Name leitet sich her von der Verbreitung durch den so
genannten Kolportage-Buchhandel, der letztendlich eine
Weiterentwicklung herkömmlichen Bücher-Hausierens darstellte.
Verlagstechnisch gesehen handelt es sich bei den Kolportageromanen um
ellenlange Fortsetzungsromane, die in Einzellieferungen unter das Volk
gebracht wurden. Ein Heft kostete in der Regel
10 Pfennige und einhundert Lieferungen und mehr pro Roman waren die
Regel. Der weiter unten angeführte Kolportageroman Der
Scharfrichter von Berlin zählte zum Beispiel 3120 Seiten,
aufgeteilt in 130 Lieferungen von je 24 Seiten /2/. Die Spannung in der
Handlung und damit der Anreiz zum Bezug des Folgeheftes wurde durch die
Cliffhanger-Methode aufrecht erhalten, ein Verfahren, welches noch
heute in Fernsehserien angewandt wird (siehe dazu weitere Erläuterungen
auf der Filmseite: August
Weichert (14. April 1854 bis 25. Okt. 1904, Bild links /1/) kam als
junger Mann nach Berlin in einer Zeit, die uns heute durch den
damaligen wirtschaftlichen Aufschwung als Gründerzeit bekannt ist. Er
begann seine Verlagsarbeit am 1. Oktober 1872 in der Barnimstr. 48, im
Berliner Nordosten. Zwar beendete die Weltwirtschaftskrise 1873 kurz
nach Verlagsgründung diese Phase der industriellen Hochkonjunktur, aber
insgesamt gesehen brachte die Zeit vor der Jahrhundertwende bis zum
Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914 eine anhaltenden Steigerung des
Wohlstandes. An diesem hatten auch die breiten Massen, wenn auch im
bescheidenen Umfang, teil. Zu dem „Luxus“, den man sich gönnte, gehörte
auch der Kauf von Literaturerzeugnissen. Genau das hatte Weichert
erkannt. Er war angetreten, um mit preiswerter Literatur die
Lesebedürfnisse der einfachen Leute zu befriedigen, waren doch bis dato
die Buchproduktionen der renommierten Verlage dem zahlungskräftigen
Bürgertum vorbehalten. In den Anfangsjahren war er spezialisiert auf
den Vertrieb von Kolportageromanen, eine Literaturgattung, die ihren
Erfolg dem sozialen Wandel in den neuen städtischen Ballungszentren
verdankte. Ihr Name leitet sich her von der Verbreitung durch den so
genannten Kolportage-Buchhandel, der letztendlich eine
Weiterentwicklung herkömmlichen Bücher-Hausierens darstellte.
Verlagstechnisch gesehen handelt es sich bei den Kolportageromanen um
ellenlange Fortsetzungsromane, die in Einzellieferungen unter das Volk
gebracht wurden. Ein Heft kostete in der Regel
10 Pfennige und einhundert Lieferungen und mehr pro Roman waren die
Regel. Der weiter unten angeführte Kolportageroman Der
Scharfrichter von Berlin zählte zum Beispiel 3120 Seiten,
aufgeteilt in 130 Lieferungen von je 24 Seiten /2/. Die Spannung in der
Handlung und damit der Anreiz zum Bezug des Folgeheftes wurde durch die
Cliffhanger-Methode aufrecht erhalten, ein Verfahren, welches noch
heute in Fernsehserien angewandt wird (siehe dazu weitere Erläuterungen
auf der Filmseite:  „Cliffhanger
Serial“ Mysterious Island – USA 1951). Das dies
notwendig war, war der knappen
finanziellen Situation der Käufer geschuldet, von denen in der Regel
weniger als zwanzig Prozent bis zur letzten Lieferung durchhielten.
Dies war der Unterschied zu Abonnements, wie sie zum Beispiel von
Hartleben bei den Lieferungsheften der Bekannten und
Unbekannten Welten praktiziert wurden. Siehe dazu die Beispiele
„Cliffhanger
Serial“ Mysterious Island – USA 1951). Das dies
notwendig war, war der knappen
finanziellen Situation der Käufer geschuldet, von denen in der Regel
weniger als zwanzig Prozent bis zur letzten Lieferung durchhielten.
Dies war der Unterschied zu Abonnements, wie sie zum Beispiel von
Hartleben bei den Lieferungsheften der Bekannten und
Unbekannten Welten praktiziert wurden. Siehe dazu die Beispiele  Lieferungshefte /
Livraisions bei Hartleben und Hetzel. Lieferungshefte /
Livraisions bei Hartleben und Hetzel.
In
den 90er Jahren folgten dann die ersten Klassikerausgaben,
die bis zur Jahrhundertwende auf zweiundzwanzig Autoren anstiegen.
Daneben gab es eine Vielzahl populärer Reihen, wie Weicherts
Criminal-Bibliothek oder die blutrünstige Sammlung
interessanter Briganten-Romane. Das größte Projekt dieser
Kleinschriftenreihen war Weicherts Wochenbibliothek.
Diese Heftreihe startete 1897 und war noch während des 1. Weltkrieges
auf dem Markt /3/. Durch das zielgerichtete Angebot von preiswerter
Ware in Massenauflagen, galt der Verlag um die Jahrhundertwende als
„Der größte Volksschriftenverlag in Deutschland“ /4/
 Als
der Firmengründer 1904 überraschend starb, übernahm sein ältester Sohn
Otto Weichert (22. November 1879 bis 9. Oktober 1945) die Geschäfte. In
dieser Aufgabe wurde er später von seinem Bruder Max Weichert (17.
April 1884 bis 16. Oktober 1945) unterstützt, der auch gleichzeitig die
Leitung der Druckerei übernahm. In der Zeit von 1901 bis 1909 erfolgte
die Herausgabe der ersten und umfassendsten Als
der Firmengründer 1904 überraschend starb, übernahm sein ältester Sohn
Otto Weichert (22. November 1879 bis 9. Oktober 1945) die Geschäfte. In
dieser Aufgabe wurde er später von seinem Bruder Max Weichert (17.
April 1884 bis 16. Oktober 1945) unterstützt, der auch gleichzeitig die
Leitung der Druckerei übernahm. In der Zeit von 1901 bis 1909 erfolgte
die Herausgabe der ersten und umfassendsten  Verne-Edition im Hause
Weichert. Inzwischen waren die Klassikerausgaben
zum festes Standbein geworden. Siehe dazu rechts einen Ausschnitt einer
Anzeige aus dem Novitäten-Anzeiger für den
Kolportage-Buchhandel Nr. 12 1900 -243, Seite 8. Neben den
Angeboten an Jugendlektüre formten sie das Profil des Verlages in der
Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Für das Jugendbuchprogramm zeichnete Walter
Heichen verantwortlich, der als Schriftsteller, Lektor und Übersetzer
agierte. Seine Berufung als Schriftsteller konnte er allerdings bei
einigen Übersetzungen nicht ganz unterdrücken und so fielen sie recht
frei aus. Am Werk Vernes lässt sich das recht gut nachvollziehen. Schon
sein Vater Paul Heichen hatte den gleichen Arbeitsstil. Verne-Edition im Hause
Weichert. Inzwischen waren die Klassikerausgaben
zum festes Standbein geworden. Siehe dazu rechts einen Ausschnitt einer
Anzeige aus dem Novitäten-Anzeiger für den
Kolportage-Buchhandel Nr. 12 1900 -243, Seite 8. Neben den
Angeboten an Jugendlektüre formten sie das Profil des Verlages in der
Zeit nach dem 1. Weltkrieg. Für das Jugendbuchprogramm zeichnete Walter
Heichen verantwortlich, der als Schriftsteller, Lektor und Übersetzer
agierte. Seine Berufung als Schriftsteller konnte er allerdings bei
einigen Übersetzungen nicht ganz unterdrücken und so fielen sie recht
frei aus. Am Werk Vernes lässt sich das recht gut nachvollziehen. Schon
sein Vater Paul Heichen hatte den gleichen Arbeitsstil.
In den Zwanziger Jahren wuchs das Verlagsprogramm auf über
dreihundert ständig lieferbare Titel an. Im „Dritten Reich“ forderte
das politische Umfeld eine Beschneidung des Verlagsprogramms, viele
Schriftsteller wurden rigoros verboten und während des Krieges wurden
die Verlagsaktivitäten stark eingeschränkt. In den letzten Kriegstagen
wurden Verlag und Druckerei, mitten in Berlin liegend, fast völlig
zerstört. Nach 1945 fielen die Reste der Firma in den
Zuständigkeitsbereich der Sowjetischen Militär-Administration, die
jedoch schon 1946 eine Verlagslizenz erteilte. Zeitgleich war von Dr.
Eugen Ottow, einem Bekannten Felix Weicherts, in Hildesheim der Verlag
Jugend und Volk neu gegründet worden. Dieser verlegte, wie
auch schon der Vorgängerverlag, mehrere Titel des jetzt Ostberliner
Weichert-Verlages in Lizenz, darunter auch mehrere Verne-Romane. 1950
wurde der Weichert-Verlag in Ostberlin / Friedrichshain enteignet und
das komplette Verlagsarchiv vernichtet (Fakten aus /1/ und /3/). 1951
fusionierte das Haus Weichert mit seinem Lizenznehmer, dem Verlag
Jugend und Volk in Hildesheim, und wurde unter dem Namen A.
Weichert in Hannover eingetragen (Fakten aus /5/). Dort und
im kleineren Umfang mit einer Außenstelle in Westberlin, setzten die
Nachfolger, der jüngste Bruder Felix Weichert und der langjährige
Prokurist Hans Limberg, ihre Arbeit fort. Sämtliche Verlagsgebiete mit
Ausnahme der Jugendbuchproduktion wurden aufgegeben. Nach mehreren
Umwandlungen gehörte die Firma seit Ende 1998 zur Sauerländer-Gruppe,
die 2001 von der Cornelson- Verlagsholding übernommen wurde /6/. Am 30.
Juni 2002 wurden alle Aktivitäten des A. Weichert Verlags eingestellt.
/7/
Frühe
Verne-Titel im Verlag August Weichert
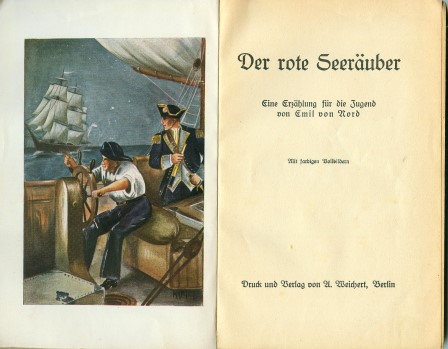 Etliche
Jahre, nachdem Jules Verne im deutschsprachigen Raum durch die Etliche
Jahre, nachdem Jules Verne im deutschsprachigen Raum durch die  Editionen
von Hartleben bereits zu einem viel
gelesenen Autor avanciert war, findet man seine gängigsten Werke auch
versteckt in den schier endlos langen Titellisten der bereits schon
erwähnten Heftreihen, die billige Unterhaltungsliteratur als Lesestoff
für breite Massen boten, und mit reißerische Überschriften vor allem
die Jugend anzog. So auch die programmatisch als Jugend- und
Volksbibliothek titulierten Reihe von Friedrichs &
Co., Verlagsanstalt in Berlin, gegr. 1888. In ihr finden wir aus dem
Jahre 1893 Die Reise um die Welt in 80 Tagen. Frei nach Jules
Verne von Rich. Krone (Band 7), Die geheimnisvolle
Insel. Eine Erzählg. v. Heinr. Schläger (Band 8) und Zwanzigtausend
Meilen unter dem Meere. Erzählung von Emil von Nord (Band
33) /8/. Editionen
von Hartleben bereits zu einem viel
gelesenen Autor avanciert war, findet man seine gängigsten Werke auch
versteckt in den schier endlos langen Titellisten der bereits schon
erwähnten Heftreihen, die billige Unterhaltungsliteratur als Lesestoff
für breite Massen boten, und mit reißerische Überschriften vor allem
die Jugend anzog. So auch die programmatisch als Jugend- und
Volksbibliothek titulierten Reihe von Friedrichs &
Co., Verlagsanstalt in Berlin, gegr. 1888. In ihr finden wir aus dem
Jahre 1893 Die Reise um die Welt in 80 Tagen. Frei nach Jules
Verne von Rich. Krone (Band 7), Die geheimnisvolle
Insel. Eine Erzählg. v. Heinr. Schläger (Band 8) und Zwanzigtausend
Meilen unter dem Meere. Erzählung von Emil von Nord (Band
33) /8/.
Besitzer von Friedrichs & Co., zu der auch eine Druckerei
gehörte, war ein gewisser Hans Heinrich Schefsky. Er entstammte einer
jüdischen Kaufmannsfamilie namens Sochaczewsky aus Breslau, den
Kurznamen legte er sich vermutlich aus gesellschaftlichen Gründen zu.
Wie dem auch sei, sein Name wäre längst in Vergessenheit geraten, wenn
er nicht durch sein Pseudonym „Victor von Falk“ in die
Literaturgeschichte eingegangen wäre. Unter diesem Pseudonym schrieb er
1889/90 den berühmtesten Kolportageroman aller Zeiten, Der
Scharfrichter von Berlin. Dessen Verleger war August Weichert.
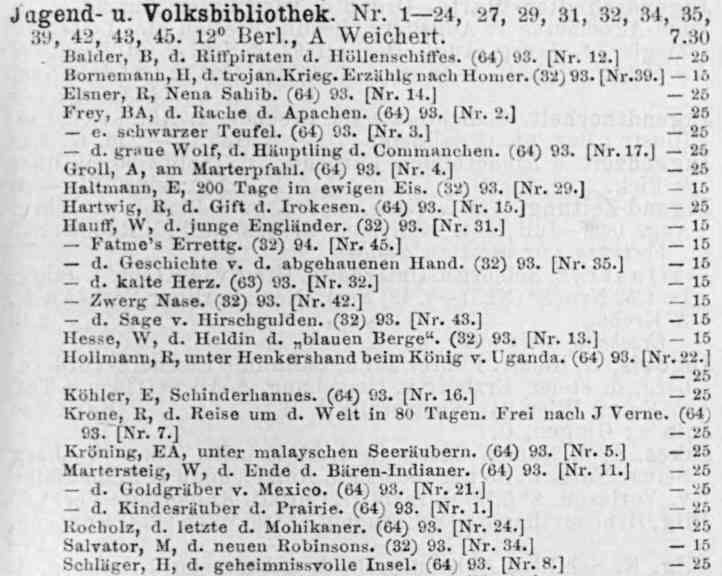 Weichert gelang es in der Folgezeit, Schefsky alias
Victor v. Falk als erfolgreichen Hausautor ganz an sich zu binden. Die
Geschäftsbeziehung ging sogar soweit, dass Schefsky im Jahre 1894 seine
Druckerei an Weichert verkaufte (aus /1/) . Weichert übernahm auch den
Verlag der Jugend- und Volksbibliothek, die er
unter dem Reihentitel Indianer- und Volksbibliothek
weiterführte. Hier erschien dann 1896 als Band 87 und – nochmals als
Neudruck 1901 – als Band 317 Emil von Nords Eine Reise nach
dem Mittelpunkt der Erde. Eine Erzählung für die Jugend. Emil
von Nord war ein typischer Autor von Trivialliteratur, der neben
eigenen Schöpfungen vor allem schon bekannte Werke ohne sich um den
Urheberschutz zu kümmern, nacherzählte. Beispiel oben links: Aus James
F. Coopers Der rote Korsar wurde bei Weichert um
1905 das Buch Der rote Seeräuber (64 Seiten, Format
18,5 x 12,5 cm; Collection Fehrmann). Genau so dreist schuf er die
Kurzfassungen der genannten Romane Jules Vernes, die eigentlich mehr
„ausgeschmückte Inhaltsangaben“ sind. Ich habe sie hier trotzdem
vorgestellt, weil sie in der defacto offiziellen deutschen
Jules-Verne-Bibliographie aufgeführt werden /9/, und auch deshalb, um
die in /1/ getroffene Feststellung „Bereits im Jahre 1895 erschien der
erste Band … »Die Reise um die Erde« … ", die immer wieder im
Zusammenhang mit Weicherts Verne-Edition zitiert wird, etwas gerade zu
rücken. Die Titelliste rechts ist vermutlich der Grund für den Irrtum.
Sie ist ein Auszug aus Hinrichs’ Fünfjahrs-Katalog 1891 bis
1895 und führt Die Reise um die Welt … und
Die geheimnissvolle Insel auf /10/. Als die
Werke, wie darin richtig dargestellt, [18]93 erschienen, war noch
Schefsky der Besitzer der Jugend- und Volksbibliothek,
als dann 1895 die Bibliographie zusammengestellt wurde, war es schon
Weichert. Weichert gelang es in der Folgezeit, Schefsky alias
Victor v. Falk als erfolgreichen Hausautor ganz an sich zu binden. Die
Geschäftsbeziehung ging sogar soweit, dass Schefsky im Jahre 1894 seine
Druckerei an Weichert verkaufte (aus /1/) . Weichert übernahm auch den
Verlag der Jugend- und Volksbibliothek, die er
unter dem Reihentitel Indianer- und Volksbibliothek
weiterführte. Hier erschien dann 1896 als Band 87 und – nochmals als
Neudruck 1901 – als Band 317 Emil von Nords Eine Reise nach
dem Mittelpunkt der Erde. Eine Erzählung für die Jugend. Emil
von Nord war ein typischer Autor von Trivialliteratur, der neben
eigenen Schöpfungen vor allem schon bekannte Werke ohne sich um den
Urheberschutz zu kümmern, nacherzählte. Beispiel oben links: Aus James
F. Coopers Der rote Korsar wurde bei Weichert um
1905 das Buch Der rote Seeräuber (64 Seiten, Format
18,5 x 12,5 cm; Collection Fehrmann). Genau so dreist schuf er die
Kurzfassungen der genannten Romane Jules Vernes, die eigentlich mehr
„ausgeschmückte Inhaltsangaben“ sind. Ich habe sie hier trotzdem
vorgestellt, weil sie in der defacto offiziellen deutschen
Jules-Verne-Bibliographie aufgeführt werden /9/, und auch deshalb, um
die in /1/ getroffene Feststellung „Bereits im Jahre 1895 erschien der
erste Band … »Die Reise um die Erde« … ", die immer wieder im
Zusammenhang mit Weicherts Verne-Edition zitiert wird, etwas gerade zu
rücken. Die Titelliste rechts ist vermutlich der Grund für den Irrtum.
Sie ist ein Auszug aus Hinrichs’ Fünfjahrs-Katalog 1891 bis
1895 und führt Die Reise um die Welt … und
Die geheimnissvolle Insel auf /10/. Als die
Werke, wie darin richtig dargestellt, [18]93 erschienen, war noch
Schefsky der Besitzer der Jugend- und Volksbibliothek,
als dann 1895 die Bibliographie zusammengestellt wurde, war es schon
Weichert.
|
![]()