|
Zur Person:
Hugo
Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967)
Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne
empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.
/1/
Sciencefiction: Ich habe mich für die Duden-konforme
Schreibweise entschieden
/2/
Brian Stbleford, John Clute, Peter Nicholls: The Encyclopedia of
Science Fiction; 1993 by John Clute Peter Nicholls
/3/
Hugo Gernsback: Amazing Stories; New York Oktober 1926; Titel siehe
unten in Blau; CF /6790/
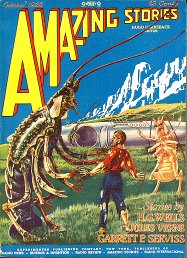
Weitere
Beispiele: Unten in Rot vom Juni 1926 und darunter
Septemberausgabe 1926
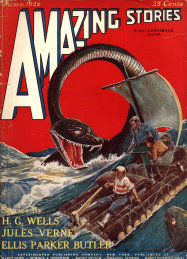
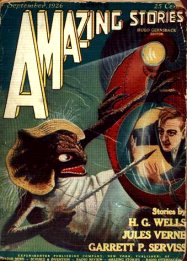
|
In
den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kam im
englischsprachigen Raum eine völlig neue Art von Zeitschriften oder
Magazinen
heraus: Preiswerte Unterhaltungsware ohne hohen Anspruch – später auch
Pulps,
Pulp-Magazine oder Pulp-Fiction genannt. Ähnlich wie im
deutschsprachigen Raum
die Groschenromane, fanden sie eine große Verbreitung. Wegbereiter im
Bereich
der Sciencefiction /1/ (siehe dazu auch meinen Beitrag:  Jules
Verne - Vater der Sciencefiction?) waren die Amazing
Stories, ein US-amerikanisches Magazin, welches im April 1926
von Hugo
Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967) erstmalig herausgegeben wurde. Es war die erste Publikation,
die sich
ausschließlich der Sciencefiction widmete. Als ich das erste Mal eine
Ausgabe
dieser Serie in der Hand hielt, war mir auch die Namensgebung des
Genres völlig
klar: Denn
„Pulp“ leitet sich von billigen holzhaltigem Papier ab, ein
Markenzeichen
dieser Art von Magazinen. Mein völlig vergilbtes und an den Kanten
bröckeliges
Exemplar war regelrecht ein sprechender Beweis der Namensgebung. Dabei
ist die Genrebezeichnung - wie viele englische Begriffe -
auch doppeldeutig interpretierbar. Denn
„Pulp“
kann auch als „Schund“ verstanden werden. Vielleicht trugen dazu die in
späteren Jahren publizierten Jungautoren und Billiglizenzen bei. Die ersten Ausgaben
wurden mit Anspruch begonnen. Jules
Verne - Vater der Sciencefiction?) waren die Amazing
Stories, ein US-amerikanisches Magazin, welches im April 1926
von Hugo
Gernsback (16. August 1884 bis 19. August 1967) erstmalig herausgegeben wurde. Es war die erste Publikation,
die sich
ausschließlich der Sciencefiction widmete. Als ich das erste Mal eine
Ausgabe
dieser Serie in der Hand hielt, war mir auch die Namensgebung des
Genres völlig
klar: Denn
„Pulp“ leitet sich von billigen holzhaltigem Papier ab, ein
Markenzeichen
dieser Art von Magazinen. Mein völlig vergilbtes und an den Kanten
bröckeliges
Exemplar war regelrecht ein sprechender Beweis der Namensgebung. Dabei
ist die Genrebezeichnung - wie viele englische Begriffe -
auch doppeldeutig interpretierbar. Denn
„Pulp“
kann auch als „Schund“ verstanden werden. Vielleicht trugen dazu die in
späteren Jahren publizierten Jungautoren und Billiglizenzen bei. Die ersten Ausgaben
wurden mit Anspruch begonnen.
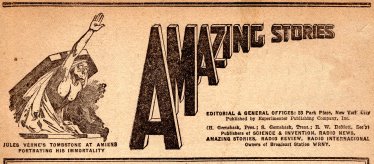 Seit
der ersten Ausgabe der Amazing Stories
war Jules Verne als Stammautor dabei. Das war nicht
von ungefähr denn Hugo Gernsback formulierte im Leitartikel der ersten
Ausgabe:
„„Mit >scientifiction< meine ich Erzählungen im Stil von
Jules Verne, H.
G. Wells und Edgar Allan Poe – eine reizvolle Phantasieerzählung mit
wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt ...
Diese
erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant,
sie sind
auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen ... in einer
ansprechenden
Form ... Neue Abenteuer, die uns die heutige Scientifiction schildert,
werden
morgen schon nicht mehr unmöglich sein ...“ /2/ Die erste Ausgabe des
Magazins
startete mit Jules Vernes Reise durch das
Sonnensystem.
Oben links im Text zeige ich die markante Titelzeile des
Inhaltsverzeichnisses mit der Grabskulptur von Jules Verne /3/. Bis
1934 hatten die Romane oder Kurzgeschichten Vernes einen
festen Platz in der Publikation. Siehe dazu vertiefend die Auflistung
weiter
unten. Das Handicap der Verne-Veröffentlichungen war aber die Art der
Wiedergabe. Die Übersetzungen basierten auf den auch in Einzelausgaben
nicht
eben guten englischen Übersetzungen, die durch Entstellungen,
Weglassungen,
politischen Korrekturen, neue Namensgebungen und falschen
Hintergrunddaten
gekennzeichnet waren. Diese schon mangelbehafteten Grundübersetzungen
wurden für
das Magazin nochmals eingekürzt. Das Ergebnis trug zwar zur
Erhöhung des
Bekanntheitsgrades Vernes in den Staaten bei, aber der literarischen
Beurteilung
seines Werkes schadete es. Diese schlampigen Übersetzungen werden auch
heutzutage noch öfters publiziert, da sie inzwischen rechtefrei sind.
Die nordamerikanische
Jules Verne Gesellschaft (North Amercan Jules Verne Society, Inc.),
sowie bewusste
Übersetzer und Literaturwissenschaftler forcieren daher seit mehreren
Jahrzenten anspruchsvolle Neuübersetzungen aus dem Französischen. Seit
der ersten Ausgabe der Amazing Stories
war Jules Verne als Stammautor dabei. Das war nicht
von ungefähr denn Hugo Gernsback formulierte im Leitartikel der ersten
Ausgabe:
„„Mit >scientifiction< meine ich Erzählungen im Stil von
Jules Verne, H.
G. Wells und Edgar Allan Poe – eine reizvolle Phantasieerzählung mit
wissenschaftlichen Tatsachen und prophetischen Weitblick vermischt ...
Diese
erstaunlichen Geschichten lesen sich nicht nur ungeheuer interessant,
sie sind
auch stets aufschlussreich. Sie vermitteln Wissen ... in einer
ansprechenden
Form ... Neue Abenteuer, die uns die heutige Scientifiction schildert,
werden
morgen schon nicht mehr unmöglich sein ...“ /2/ Die erste Ausgabe des
Magazins
startete mit Jules Vernes Reise durch das
Sonnensystem.
Oben links im Text zeige ich die markante Titelzeile des
Inhaltsverzeichnisses mit der Grabskulptur von Jules Verne /3/. Bis
1934 hatten die Romane oder Kurzgeschichten Vernes einen
festen Platz in der Publikation. Siehe dazu vertiefend die Auflistung
weiter
unten. Das Handicap der Verne-Veröffentlichungen war aber die Art der
Wiedergabe. Die Übersetzungen basierten auf den auch in Einzelausgaben
nicht
eben guten englischen Übersetzungen, die durch Entstellungen,
Weglassungen,
politischen Korrekturen, neue Namensgebungen und falschen
Hintergrunddaten
gekennzeichnet waren. Diese schon mangelbehafteten Grundübersetzungen
wurden für
das Magazin nochmals eingekürzt. Das Ergebnis trug zwar zur
Erhöhung des
Bekanntheitsgrades Vernes in den Staaten bei, aber der literarischen
Beurteilung
seines Werkes schadete es. Diese schlampigen Übersetzungen werden auch
heutzutage noch öfters publiziert, da sie inzwischen rechtefrei sind.
Die nordamerikanische
Jules Verne Gesellschaft (North Amercan Jules Verne Society, Inc.),
sowie bewusste
Übersetzer und Literaturwissenschaftler forcieren daher seit mehreren
Jahrzenten anspruchsvolle Neuübersetzungen aus dem Französischen.
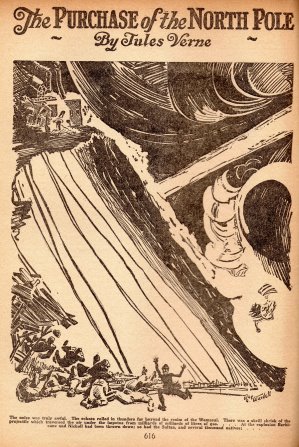 Der Pioniergeist, die Breite der fiktionalen
Angebote und
die reißerische Aufmachung der Amazing
Stories prägte das Leseverhalten ganzer Generationen meist
jüngeren
männlichen Lesern im Zeitraum von fast achtzig Jahren. Die Bereitschaft
der
Leser sich der dem Thema Sciencefiction zu widmen, führte in der Folge
auch zur
Szenebildung und einer breitgefächerten Fangemeinde. Ab zirka 1965
beschränkte
sich das Magazin fast ausschließlich auf Nachdrucke älterer, schon im
Magazin
herausgegebener Geschichten oder billig eingekaufter Druckrechte
unbekannter
Autoren. In den 80ziger Jahren wurden die Inhalte wieder
anspruchsvoller, aber
die große Zeit des Magazins war vorbei. Im Jahre 2013 begann der
Versuch, den
gut bekannten Namen für ein online Sciencefiction-Magazin zu nutzen. Der Pioniergeist, die Breite der fiktionalen
Angebote und
die reißerische Aufmachung der Amazing
Stories prägte das Leseverhalten ganzer Generationen meist
jüngeren
männlichen Lesern im Zeitraum von fast achtzig Jahren. Die Bereitschaft
der
Leser sich der dem Thema Sciencefiction zu widmen, führte in der Folge
auch zur
Szenebildung und einer breitgefächerten Fangemeinde. Ab zirka 1965
beschränkte
sich das Magazin fast ausschließlich auf Nachdrucke älterer, schon im
Magazin
herausgegebener Geschichten oder billig eingekaufter Druckrechte
unbekannter
Autoren. In den 80ziger Jahren wurden die Inhalte wieder
anspruchsvoller, aber
die große Zeit des Magazins war vorbei. Im Jahre 2013 begann der
Versuch, den
gut bekannten Namen für ein online Sciencefiction-Magazin zu nutzen.
Für den
Verneasten
sind folgende Ausgaben von Interesse:
Erste Serie
(Vol. 1)
No. 1, April 1926
Jules Verne: Off on a
Comet, or
Hector Servadac (Reise durch das Sonnensystem), Teil 1
No. 2, Mai 1926
Jules Verne: Off on a
Comet, or
Hector Servadac (Reise durch das Sonnensystem), Teil 2 und A
Trip to the
Center of the Earth (Reise zum Mittelpunkt der Erde), Teil 1
No. 3, Juni 1926
Jules Verne: A Trip to the
Center of
the Earth, (Reise zum Mittelpunkt der Erde),
Teil 2
No. 4, Juli 1926
Jules Verne: A Trip to the
Center of
the Earth (Reise zum Mittelpunkt der Erde), Teil 3
No. 5, August 1926
Jules Verne: Dr Ox's
Experiment, in einem Teil
No. 6, September 1926
Jules Verne: Purchase of
the North
Pole (Kein Durcheinander), Teil 1 - siehe dazu Illustration
oben rechts im Text /3/
No.
7, Oktober 1926
Jules Verne: Purchase of
the North
Pole (Kein Durcheinander), Teil 2
No.
8, November 1926
Jules Verne: Drama in the Air (Ein
Drama in den Lüften), in einem Teil
Zweite Serie
(Vol. 2)
No. 9, Dezember 1926
Jules Verne: Robur the
Conqueror, or
the Clipper of the Air / Clipper of the Clouds (Robur der Eroberer),
Teil 1
No. 10, Januar 1928
Jules Verne: Robur the
Conqueror, or
the Clipper of the Air / Clipper of the Clouds (Robur der Eroberer),
Teil 2
No. 11, Februar 1928
Jules Verne: Master of the
World
(Der Herr der Welt), Teil 1
No. 12, März 1928
Jules Verne: Master
of the World
(Der Herr der Welt), Teil 2
Vierte Serie
(Vol. 4)
No. 2, Mai 1929
Jules Verne: The English at
the
North Pole (Kapitän Hatteras – erster Teil des Romans), Teil 1
No. 3, June 1929
Jules Verne: The English at
the
North Pole (Kapitän Hatteras - erster Teil des Romans), Teil
2 und The
Desert of Ice (Kapitän Hatteras – zweiter Teil des Romans),
Teil 1
No.
4, July 1929
Jules Verne: The Desert of
Ice (Kapitän
Hatteras – zweiter Teil des Romans), Teil 2
Achte
Serie (Vol. 8)
No. 8, July 1933
Jules Verne: The Watch's
Soul
(Master Zacharius / Meister Zacharius),
in einem Teil
Jules Verne: Winter Amid
the Ice, or
the Cruise of the Jeune-Hardie (Eine
Überwinterung im Eis), in einem Teil
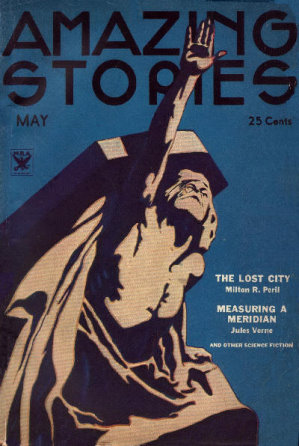 Neunte
Serie (Vol. 9) Neunte
Serie (Vol. 9)
No.
1, May 1934
Jules
Verne:
Measuring a Meridian (Abenteuer
dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),
Teil 1
In
dieser Ausgabe erschien sogar das Bild von Vernes Grab-Skulptur von
Roziere auf der Titelseite des Magazins. Dazu gab es Innen eine
Erläuterung zum
Leben Vernes und dem Bezug zu Amiens für die Leser. Der Vorschlag zu
dieser
Cover-Gestaltung kam übrigens durch eine Leserzuschrift die im Juli
1933 in den
Stories abgedruckt wurde. Siehe rechts.
No.
2, June 1934
Jules Verne: Measuring a
Meridian (Abenteuer
dreier Russen und
dreier Engländer in Südafrika),
Teil 2
No.
3, July 1934
Jules
Verne:
Measuring a Meridian (Abenteuer
dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),
Teil 3
No.
4, August 1934
Jules Verne: Measuring a
Meridian
(Abenteuer
dreier Russen und dreier Engländer in Südafrika),
Teil 4 (Hinweis: Eigentlich sollte es nur 3 Teile geben, aber es sind 4
geworden)
|
 Personenregister dieser Domain.
Personenregister dieser Domain.