|
Das Buch zum Theaterstück: 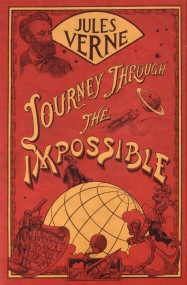
/2/
Quellen:
/1/ Adolf Philipp d'Ennery in einer
zeitgenössischen Darstellung von 1880 aus Olivier & Patrick
Poivre D'Arvour: Le monde selon Jules Verne
Éditions Mengés, Paris 12/2004; ISBN 2-7441-7920-5; Bildzitat von Seite
110 (Bild wurde von mir stark nachgearbeitet)
Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne
empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.
/2/ Jules Verne Journey Through The
Impossible © Prometheus Books Amherst NY, USA 2003; ISBN
1-59102-079-4; Übersetzt von Edward Baxter, mit einer Einleitung von
Jean-Michel Margot; CF /7002/
/3/
ebenda;Illustrationen von Roger Leyonmark
/4/ Volker
Dehs: Jules Verne; Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
1986, 1988, 2000, 2005, Reinbek bei Hamburg; ISBN 3 499 50358 1 (CF
/5501/); Zitat v. Seite 99
/5/ Journal
Le Monde Illustre vom 2. Dezember 1882: Das Stück im Théâtre de la
Porte Saint-Martin; Titelblatt
/6/
Ebenda; Ausschnitt aus einer Seite; Darstellung des Untergangs des
Planeten Altor
|
Voyage à
travers l’impossible (Reise durch das Unmögliche) 1882
 Das Theaterstück von 1882 unter dem Titel: Voyage
à travers l'impossible schrieb Verne zusammen mit Adolphe
d'Ennery ab 1879 (Bild rechts /1/). Siehe zu seiner Person und seinem Werk vertiefend meine Seite Das Theaterstück von 1882 unter dem Titel: Voyage
à travers l'impossible schrieb Verne zusammen mit Adolphe
d'Ennery ab 1879 (Bild rechts /1/). Siehe zu seiner Person und seinem Werk vertiefend meine Seite  Adolphe d'Ennery - Dramatiker der Werke Jules Vernes). D'Ennery (1811 – 1899 hatte wie
Verne, ebenfalls juristische Wurzeln, war er doch vor seiner Tätigkeit
als Journalist und Stückeschreiber, Schreiber bei einem Notar. Durch
seine populäre Art des Schreibens wurde er bald zu einem erfolgreichen
Bühnendichter. Voyage à travers l'impossible war
eigentlich die Fortsetzung einer fruchtbaren Zusammenarbeit, hatte man
doch schon zusammen einige Stücke auf die Bühne gebracht. Der gewohnte
Erfolg hielt sich aber im Rahmen, das Stück hat seine Zeit nicht
überlebt. Die Musik für dieses Libretto wurde von Oscar de Lagoanère
geschrieben. Die Erstaufführung war am 25. 11. 1882 in Paris, im Adolphe d'Ennery - Dramatiker der Werke Jules Vernes). D'Ennery (1811 – 1899 hatte wie
Verne, ebenfalls juristische Wurzeln, war er doch vor seiner Tätigkeit
als Journalist und Stückeschreiber, Schreiber bei einem Notar. Durch
seine populäre Art des Schreibens wurde er bald zu einem erfolgreichen
Bühnendichter. Voyage à travers l'impossible war
eigentlich die Fortsetzung einer fruchtbaren Zusammenarbeit, hatte man
doch schon zusammen einige Stücke auf die Bühne gebracht. Der gewohnte
Erfolg hielt sich aber im Rahmen, das Stück hat seine Zeit nicht
überlebt. Die Musik für dieses Libretto wurde von Oscar de Lagoanère
geschrieben. Die Erstaufführung war am 25. 11. 1882 in Paris, im  Théâtre de la Porte Saint-Martin. Das Stück wurde 97 mal zwischen 1882 und 1883
aufgeführt. Es galt lange als verschollen, erst 1979 ist das verloren
geglaubte Manuskript wieder aufgetaucht. Die Erstausgabe in Buchform
erfolgte daher erst 1981 durch Jean-Jacques Pauvert. Théâtre de la Porte Saint-Martin. Das Stück wurde 97 mal zwischen 1882 und 1883
aufgeführt. Es galt lange als verschollen, erst 1979 ist das verloren
geglaubte Manuskript wieder aufgetaucht. Die Erstausgabe in Buchform
erfolgte daher erst 1981 durch Jean-Jacques Pauvert.
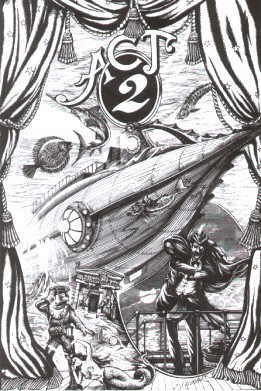 Das Stück ist ein Konglomerat
verschiedener Romane und der Helden Jules Vernes. In einer kleinen
Stadt in Dänemark lebt Georges Hatteras, Sohn des wahnsinnigen Kapitän
Hatteras. Er wird vom berühmten Wissenschaftler Doktor Ox angehalten,
die Sache des Vaters fortzuführen. Dabei spielt Ox, ähnlich wir es von
Goethes „Faust“ kennen, die Rolle eines „Mephistos“. Der Handlungsfaden
des Stückes ist eigentlich eine Reisebeschreibung quer durch Reiseziele
der „Außergewöhnlichen Reisen“. Auf ständiger Suche nach immer Neuem,
begegnen die Akteure Personen die wir schon kennen. So Lidenbrock im
Akt 1: „Der Mittelpunkt der Erde“, Nemo im Akt 2: „Am Grunde des
Meeres“ und Ardan (und die Bewohner des Planenten Altor) im Akt 3: „Der
Planet Altor“. Alle wollen den jungen Hatteras von seinem Größenwahn
abbringen. Denn dieser hat es sich in den Kopf gesetzt, immer weiter
vordringen zu wollen. Das Stück ist ein Konglomerat
verschiedener Romane und der Helden Jules Vernes. In einer kleinen
Stadt in Dänemark lebt Georges Hatteras, Sohn des wahnsinnigen Kapitän
Hatteras. Er wird vom berühmten Wissenschaftler Doktor Ox angehalten,
die Sache des Vaters fortzuführen. Dabei spielt Ox, ähnlich wir es von
Goethes „Faust“ kennen, die Rolle eines „Mephistos“. Der Handlungsfaden
des Stückes ist eigentlich eine Reisebeschreibung quer durch Reiseziele
der „Außergewöhnlichen Reisen“. Auf ständiger Suche nach immer Neuem,
begegnen die Akteure Personen die wir schon kennen. So Lidenbrock im
Akt 1: „Der Mittelpunkt der Erde“, Nemo im Akt 2: „Am Grunde des
Meeres“ und Ardan (und die Bewohner des Planenten Altor) im Akt 3: „Der
Planet Altor“. Alle wollen den jungen Hatteras von seinem Größenwahn
abbringen. Denn dieser hat es sich in den Kopf gesetzt, immer weiter
vordringen zu wollen.
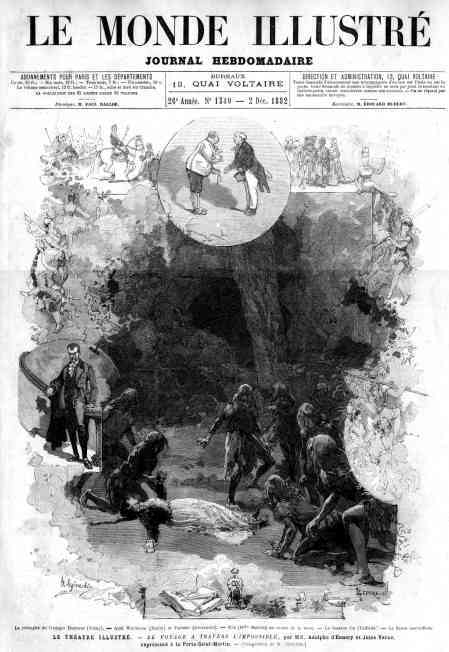 Dabei
lässt Verne bekannte Schauplätze Revue passieren: Über einen Berggipfel
gelangen die Reisenden in das innere der Erde,wo sie von einer
phantastischen unterirdischen Vegetation umgeben sind. Später geht es
mit Nemo und der Nautilus unter das Meer, die versunkene Stadt Atlantis
wird besucht und nach einigen „politischen“ Wirren gelangen die
Reisenden wieder auf das Festland, diesmal zum „Gun Club“. Mit Hilfe
dieser „Spezialisten“ gelangen die Reisenden mit einem Geschoss zum
Planeten Altor. Weil die Bevölkerung von Altor unter Führung von
Hatteras zwecks „Fruchtbarmachung“ des Planeten die Meere in das
Planeteninnere leiten wollte, kommt es zu einer riesigen Explosion.
Schlagartig befinden sich die Reisenden wieder am Ausgangspunkt ihrer
Reise, im Schloss Andernak in Dänemark. Dabei
lässt Verne bekannte Schauplätze Revue passieren: Über einen Berggipfel
gelangen die Reisenden in das innere der Erde,wo sie von einer
phantastischen unterirdischen Vegetation umgeben sind. Später geht es
mit Nemo und der Nautilus unter das Meer, die versunkene Stadt Atlantis
wird besucht und nach einigen „politischen“ Wirren gelangen die
Reisenden wieder auf das Festland, diesmal zum „Gun Club“. Mit Hilfe
dieser „Spezialisten“ gelangen die Reisenden mit einem Geschoss zum
Planeten Altor. Weil die Bevölkerung von Altor unter Führung von
Hatteras zwecks „Fruchtbarmachung“ des Planeten die Meere in das
Planeteninnere leiten wollte, kommt es zu einer riesigen Explosion.
Schlagartig befinden sich die Reisenden wieder am Ausgangspunkt ihrer
Reise, im Schloss Andernak in Dänemark.
Nachtrag:
Volker Dehs schreibt in seiner RORORO-Biographie: „Trotz seiner vielen Schwächen
erhält das Stück dadurch Bedeutung, daß es Vernes einmaligen Versuch
darstellt, durch einen korrektiven Rückbezug auf seine erfolgreichsten
Titel Einfluß darauf zu gewinnen, wie das Romanwerk zu verstehen sei.
So verwundert es nicht, daß die Verleger das Werk mißbilligen und nicht
herausbringen: »Ein einziger Unsinn ist das«, schreibt Louis-Jules
Hetzel seinem Vater. »Außergewöhnliches soll er machen, und nicht
Unmögliches; es besteht aber keine Aussicht, diesen Bretonen von seinen
einmal gefaßten Gedanken wieder abzubringen.« Aus heutiger Sicht läßt
sich nur hinzufügen: Zum Glück!“ /4/. Nachfolgende Bilder: /5/ und /6/

|

![]()