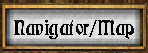|
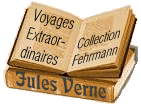
Die eigentlichen Informationen zum
Buch und dessen Verfilmungen sind meinen Seiten:  Voyages
Extraordinaires: Band 12 – Die Geheimnisvolle Insel zu entnehmen. Wie wir uns die
LINCOLN - Insel vorstellen können, habe ich versucht auf meiner
Seite: Voyages
Extraordinaires: Band 12 – Die Geheimnisvolle Insel zu entnehmen. Wie wir uns die
LINCOLN - Insel vorstellen können, habe ich versucht auf meiner
Seite:  Versuch einer Rekonstruktion darzustellen. Versuch einer Rekonstruktion darzustellen.
Quellen und Hinweise:
/1/ Illustration oben: Aus einer
amerikanischen Ausgabe von 1918, Illustrator: N.C. Wyeth. Wer
mehr Bilder davon sehen möchte: Hier meine Seite  The
Mysterious Island – Illustrationen von N.C. Wyeth The
Mysterious Island – Illustrationen von N.C. Wyeth
/2/ Die Aufstellung (jeweils in Blau) ist der
Ausgabe Bücherbund, 1989 in der Übersetzung von Waldtraut
Henschel-Villaret entnommen, S. 226 und 227 – CF /1206/, teilweise
ergänzt durch andere Übersetzungen
/3/ Letosnikova/Hercik: Waffen, Schützen, Büchsenmacher ,
ALBATROS Praha 1982
/4/ Foto © Fehrmann 2003; Abbildung meines eignen
Instruments: Spiegelsextant
/5/ Rulemann: Die Wunder der Physik
Verlagsdruckerei Merkur Berlin, 1900
/6/ Autorenkollektiv: Kleines Realienbuch,
Polack, Verlag Theodor Hofmann, Leipzig und Berlin, 1904
/7/ Samter: Das Reich der Erfindungen,
Verlag Gondrom, 1901
/8/ Kahnmeyer: Realienbuch, Verlag
unbekannt, 1920
/9/ Autorenkokllektiv: Zur
Geschichte der Textiltechnik: Von der Faser zum Gewand,
Kosmosverlag Stuttgart, 1920
Alle Quellen aus Collection Fehrmann
|
Auf
dieser Seite gibt es weitere Details zur Rekonstruktion der
Lebensverhältnisse auf der Insel. So wollen wir gemeinsam den Inhalt
des rätselhaften Strandgutes näher untersuchen, welches auf
überraschender Weise angeschwemmt wurde. In der Folge brachte es für
alle eine Verbesserung der Situation auf dem Eiland.
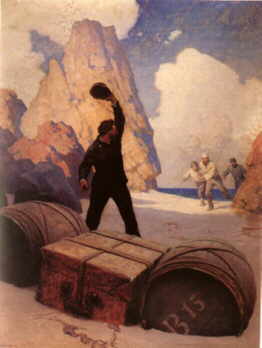 Bei der
ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren
die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der
Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in
Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine
Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender
Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht
waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links
/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die
Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen
Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,
gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer
zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die
Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle
ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein
Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns
einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen. Bei der
ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren
die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der
Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in
Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine
Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender
Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht
waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links
/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die
Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen
Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,
gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer
zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die
Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle
ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein
Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns
einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.
Die Listung der Gegenstände habe ich aus einer
meiner über siebzig vorliegenden Buchvarianten der Geheimnisvollen Insel zitiert
und nachfolgend in BLAU
dargestellt /2/. Damit wir uns eine Vorstellung von den
Ausrüstungsteilen machen können, habe ich mich bemüht Bildbeispiele zu
finden, die unsere Vorstellungen davon konkreter werden lassen.
Immerhin sind ja rund 150 Jahre seit der Handlung des Buches vergangen.
Machen wir also einen kleinen praktischen Ausflug in die Vergangenheit.
WERKZEUGE:
3
Messer mit mehreren Klingen – 2 Holzfälleräxte – 2 Zimmermannsbeile – 2
Hohlbeile - 3 Hobel – 1 Queraxt – 6 Bankmesser – 2 Feilen – 3 Hämmer –
3 Bohrer – 2 Hohlbohrer – (in anderen Ausgaben ist noch ergänzt: 10
Säcke mit Nägeln und Schrauben – 3 Sägen verschiedener Größe – 2
Büchsen mit Nadeln)
WAFFEN:
2 Steinschloßgewehre – 2 Perkussionsgewehre – 2
Karabiner mit Zentralzündung (Zentralfeuerkarabiner) – 5 Seitengewehre
– 4 Enterhaken – 2 Fässer mit je 25 Pfund Pulver – 12 Schachteln mit
Zündpatronen (Zündhütchen)
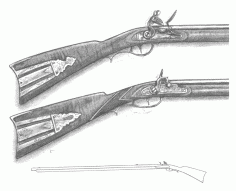 Steinschloßgewehre: Links
zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser
Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr
mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten
einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut
verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe
zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu
sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen? Steinschloßgewehre: Links
zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser
Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr
mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten
einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut
verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe
zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu
sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?
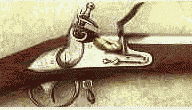 Rechts
sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt
zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff
Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie
bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe
Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung. Rechts
sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt
zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff
Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie
bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe
Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.
 Perkussionsgewehre: Bei einer
Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt
ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.
Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem
oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in
Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des
Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der
Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur
damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45
(ungefähr 11,5 mm). Perkussionsgewehre: Bei einer
Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt
ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.
Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem
oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in
Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des
Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der
Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur
damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45
(ungefähr 11,5 mm).
 Karabiner mit Zentralzündung: Nun
zu den Karabinern: Wenn ich mein 1888er Brockhaus
Conversations-Lexikon befrage, dann „ist ein
Karabiner das Feuergewehr der Kavallerie. Es ist kürzer und leichter
als das der Infanterie, früher auch von kleinerem Kaliber“.
Der Karabiner - im englischen carbine - galt als typische
Waffe im amerikanischen Bürgerkrieg. Rechts ist beispielhaft der SMITH
CARBINE 50 cal percussion breechloader dargestellt. Zeitlich fast
gleich mit unserer Romangeschichte hielt eine anderer Karabiner seinen
Einzug in den kämpfenden Truppen: der „Henry Repeating-Rifle“, der auch
als Winchester bekannt wurde. Da aber bei der Ausrüstung unserer
Kolonisten keine Patronen dabei waren, und auch die
Aussage Zentralzündung gemacht wurde, muss es sich um eine
ähnliche wie die oben abgebildete Waffe gehandelt haben. Die Seitengewehre sind entweder
separat als Stichwaffe geplant gewesen, oder sie waren als Ergänzung
der Gewehre mit eingepackt worden. Karabiner mit Zentralzündung: Nun
zu den Karabinern: Wenn ich mein 1888er Brockhaus
Conversations-Lexikon befrage, dann „ist ein
Karabiner das Feuergewehr der Kavallerie. Es ist kürzer und leichter
als das der Infanterie, früher auch von kleinerem Kaliber“.
Der Karabiner - im englischen carbine - galt als typische
Waffe im amerikanischen Bürgerkrieg. Rechts ist beispielhaft der SMITH
CARBINE 50 cal percussion breechloader dargestellt. Zeitlich fast
gleich mit unserer Romangeschichte hielt eine anderer Karabiner seinen
Einzug in den kämpfenden Truppen: der „Henry Repeating-Rifle“, der auch
als Winchester bekannt wurde. Da aber bei der Ausrüstung unserer
Kolonisten keine Patronen dabei waren, und auch die
Aussage Zentralzündung gemacht wurde, muss es sich um eine
ähnliche wie die oben abgebildete Waffe gehandelt haben. Die Seitengewehre sind entweder
separat als Stichwaffe geplant gewesen, oder sie waren als Ergänzung
der Gewehre mit eingepackt worden.
 Enterhaken gehörten
zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren
sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu
besteigen, was man auch alternativ mit
kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden
als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum
Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem
Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist
auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung
ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf
diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne
Form abgebildet. Enterhaken gehörten
zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren
sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu
besteigen, was man auch alternativ mit
kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden
als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum
Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem
Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist
auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung
ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf
diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne
Form abgebildet.
INSTRUMENTE:
1
Sextant – 1 Wasserwaage – 1 Fernrohr – 1 großer Kompass – 1
Taschenkompass – 1 Thermometer nach Fahrenheit – 1 Aneroid-Barometer –
1 vollständiger Fotoapparat: Opbjektiv, Platten, Chemikalien usw.
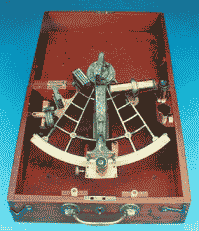  Sextant:
Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit
einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und
Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links
an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis
Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den
Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man
errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun
Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von
60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der
Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente
wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links
ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer
abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik
der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im
Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der
Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen
hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die
Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel
findet man auf meiner Seite: Sextant:
Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit
einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und
Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links
an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis
Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den
Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man
errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun
Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von
60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der
Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente
wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links
ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer
abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik
der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im
Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der
Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen
hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die
Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel
findet man auf meiner Seite:  Der Sextant – Nautik bei Jules Verne Der Sextant – Nautik bei Jules Verne
 Fernrohr: Der
Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten
Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele
Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich
beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine
Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft. Fernrohr: Der
Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten
Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele
Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich
beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine
Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.
  Großer Kompass
und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die
konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung
meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also
Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.
Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer
Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die
Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So
wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim
Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für
Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass
nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders
geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei
Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte
ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich. Großer Kompass
und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die
konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung
meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also
Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.
Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer
Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die
Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So
wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim
Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für
Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass
nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders
geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei
Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte
ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich.
Abweichungen
im Erdmagnetfeld und die Ablenkung bei den zunehmend eingesetzten
Bauteilen aus Eisen auf den Schiffen führten gegen Ende des 19.
Jahrhunderts dann zur Entwicklung des Kreiselkompasses. Aber das ist
bereits unserer Geschichte voraus. Rechts sehen wie einen kleinen
Taschenkompass (Bildquelle /5/) aus der Zeit um 1880, in einfachster
Ausführung. Ich denke so ähnlich werden wir uns die beiden Geräte
vorstellen können.
 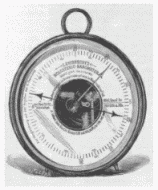 Thermometer: Links ein altes
Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker
benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/). Thermometer: Links ein altes
Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker
benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).
Aneroid-Barometer:
Rechts ist ein Aneroidbarometer zu sehen (Bildquelle
/7/). Diese Barometer werden auch Dosenbarometer genannt, weil das
eigentliche Innenleben eine Metalldose ist, aus der weitestgehend die
Luft evakuiert wurde. Durch eine inne liegende Feder wird dafür
gesorgt, das die Metallhülle nicht völlig zusammengepresst wird. Ändert
sich jetzt der Luftdruck, so wird die Feder gebogen und über eine
Übersetzung, meist in Form eines Armes wird, wie rechts gut zu sehen
ist, der Druck mittels eines Zeigers auf einer speziell eingerichteten
Skala angezeigt. Solche präzise arbeitenden Instrumente dienen der
Messung des absoluten athmosphärischen Luftdrucks. Sie wurden und
werden in der Seefahrt, in der Meteorologie und in der Forschung
eingesetzt.
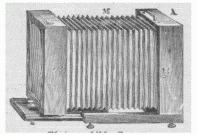 Fotoapparat: Mit dieser kurzen
und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am
plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)
einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem
Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich
vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für
Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den
stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine
interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite Fotoapparat: Mit dieser kurzen
und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am
plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)
einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem
Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich
vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für
Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den
stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine
interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite  Claudius Bombarnac
aufgezeigt. Denn erst
1893 gelang es dem Amerikaner George Eastman die Kompaktkamera
(Kodak-Box) zu entwickeln. Aber wir müssen wieder in der Zeit
zurückspringen. In anderen Büchern fand ich Modelle von 1860, die aus
zwei Holzkästen bestanden, die sich zur Scharfeinstellung in einander
schieben ließen. Vielleicht ließ sich Verne auch von den 1835 bis 1839
entwickelten Apparaten zur Herstellung von
Daguerrotypien, nach einem Pariser Optiker benannt,
inspirieren. Die dort verwendeten Platten konnten vom Fotografen mit
chemischen Kenntnissen mit Hilfe einfachster Hilfsmittel selbst
hergestellt werden. Claudius Bombarnac
aufgezeigt. Denn erst
1893 gelang es dem Amerikaner George Eastman die Kompaktkamera
(Kodak-Box) zu entwickeln. Aber wir müssen wieder in der Zeit
zurückspringen. In anderen Büchern fand ich Modelle von 1860, die aus
zwei Holzkästen bestanden, die sich zur Scharfeinstellung in einander
schieben ließen. Vielleicht ließ sich Verne auch von den 1835 bis 1839
entwickelten Apparaten zur Herstellung von
Daguerrotypien, nach einem Pariser Optiker benannt,
inspirieren. Die dort verwendeten Platten konnten vom Fotografen mit
chemischen Kenntnissen mit Hilfe einfachster Hilfsmittel selbst
hergestellt werden.
 KLEIDUNGSSTÜCKE: KLEIDUNGSSTÜCKE:
2
Dutzend Hemden von merkwürdigen Gewebe, wollähnlich, vermutlich aus
einem Pflanzenstoff gefertigt – 3 Dutzend Strümpfe vom gleichen Gewebe
Gerade
in der Bekleidungsfrage standen die Kolonisten vor ernsten Problemen.
Man kann sich leicht vorstellen, welchem Verschleiß die Sachen hatten,
waren doch alle in ihrem Kampf um die tägliche Sicherung der Versorgung
ständig im Wald oder am Strand unterwegs. Gleichzeitig mussten aber
auch alle handwerklichen Aktivitäten in der selben Bekleidung
durchgeführt werden. Später ergänzte man auch ein Teil der Ausrüstung
durch Nutzung von Fellen, Leder und dann nach Bau der Walkmühle, durch
die Herstellung von Filzprodukten. (Bildbeispiel /9/)
HAUSGERÄTE:
1
eiserner Flaschenkessel – 6 reichlich große Pfannen aus Kupfer
(Kasserollen aus verzinnten Kupfer) – 3 Schüsseln aus Eisenblech – 10
Bestecke aus Aluminium – 2 Kochkessel – 1 kleiner tragbarer Herd (Ofen)
– 6 Tischmesser
BÜCHER:
1 Bibel mit Altem und Neuen Testament – 1 Atlas – 1
Wörterbuch der verschiedenen polynesischen Mundarten (in 6 Bänden) – 1
Wörterbuch der Naturwissenschaften (ausführliche Naturgeschichte) – 3
Ries weißes Papier – 2 Bücher mit unbeschriebenen Seiten (Schreibhefte
mit weißen Blättern) Ende der Aufstellung des geheimnisvollen Strandgutes.
NACH OBEN - SEITENANFANG
|
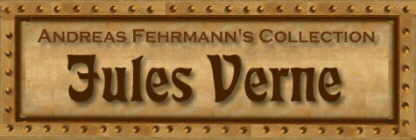
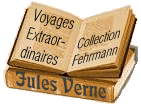

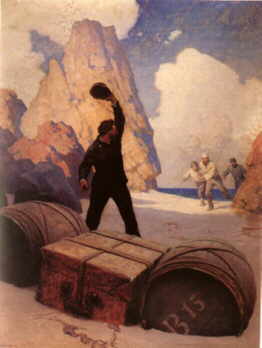 Bei der
ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren
die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der
Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in
Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine
Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender
Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht
waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links
/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die
Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen
Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,
gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer
zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die
Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle
ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein
Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns
einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.
Bei der
ersten Probefahrt der mit einfachsten Mitteln gebauten Piroge fuhren
die Kolonisten in Richtung Südspitze des Eilandes. Vorbei an der
Mündung des Gnadenbaches fuhr man an den Tadornensumpf vorbei, in
Richtung Kap Klaue. Unterhalb des Tadornensumpfes gab es eine kleine
Einbuchtung. Dort trieben Fässer, die seitlich als unterstützender
Auftrieb für eine große seewasserfeste Kiste an dieser angebracht
waren. Sofort begann man dieses Strandgut zu bergen (siehe Bild links
/1/). Um keinen Schaden anzurichten, beschlossen unsere Freunde, die
Fundsachen zum Granithaus zu verbringen. Als das Strandgut unter vielen
Mühen bis zum Strand unterhalb des Granithauses zurückgeschleppt wurde,
gab es beim Öffnen eine große Überraschung! In der Kiste, unter einer
zugelöteten Zinkummantelung waren wahre Schätze verborgen. Denn die
Vielzahl der praktischen Dinge die dort enthalten waren, waren für alle
ein Schatz. Da Gideon Spillett den Inhalt fein säuberlich in sein
Notizbuch eintrug, haben wir eine genaue Aufstellung und wir wollen uns
einige Teile der Ausrüstung etwas näher ansehen.
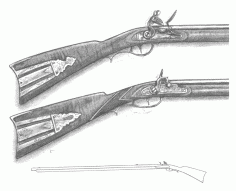 Steinschloßgewehre: Links
zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser
Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr
mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten
einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut
verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe
zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu
sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?
Steinschloßgewehre: Links
zeige ich euch als Beispiele Pennsylvanische Gewehre, die in dieser
Form bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Oben ein Gewehr
mit Steinschloß und unten eins mit Perkussionsschloß. Die Waffen hatten
einen langen kannelierten Lauf, der das benutzte Schwarzpulver gut
verbrannte und genügend Gas entwickelte. Um die Proportionen der Waffe
zu erkennen, ist im unteren Teil des Bildes noch eine Gesamtskizze zu
sehen (Bildquelle /3/). Was ist das typische dieser Waffen?
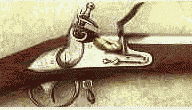 Rechts
sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt
zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff
Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie
bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe
Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.
Rechts
sehen wir das Schloß einer Steinschloßwaffe. Der Ladevorgang erfolgt
zuerst durch Füllen des Pulvers in den Lauf (daher auch der Begriff
Vorderlader), dann folgt die Kugel. Der Zündvorgang läuft ab wie
bereits im Mittelalter angewandt: Ein Feuerstein der über eine rauhe
Fläche reibt, bildet einen Funken und dieser zündet die Pulverladung.
 Perkussionsgewehre: Bei einer
Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt
ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.
Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem
oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in
Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des
Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der
Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur
damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45
(ungefähr 11,5 mm).
Perkussionsgewehre: Bei einer
Perkussionswaffe, deren Schloss beispielhaft links dargestellt
ist, werden zum Zünden des Pulvers so genannte Zündhütchen aufgesetzt.
Diese Aufsatzstelle nennt man Piston. Das Aufsetzen erfolgt nach dem
oben beschriebenen Ladevorgang. Nachdem ich mich ein bisschen in
Waffenkunde belesen habe, nehme ich an, das der Übersetzer des
Vernewerkes die eben geschilderten Zündhütchen meinte, wenn er in der
Listung von Zündpatronen spricht. Das Kaliber der Waffen war zur
damaligen Zeit meist Kal. 52 oder 54 (Fabrikat SHARPS) oder Kal. 45
(ungefähr 11,5 mm). Karabiner mit Zentralzündung: Nun
zu den Karabinern: Wenn ich mein
Karabiner mit Zentralzündung: Nun
zu den Karabinern: Wenn ich mein  Enterhaken gehörten
zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren
sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu
besteigen, was man auch alternativ mit
kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden
als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum
Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem
Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist
auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung
ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf
diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne
Form abgebildet.
Enterhaken gehörten
zur klassischen Bewaffnung der Piraten und der Marinesoldaten, waren
sie doch eigentlich gedacht, die Bordwände der zu enterner Schiffe zu
besteigen, was man auch alternativ mit
kleinen Wurfankern erreichen konnte oder die Enterhaken wurden
als Nahkampfwaffe verwendet. Gleichzeitig nutze man sie aber auch zum
Bugsieren der Beiboote oder zum Herausfischen von Gegenständen aus dem
Wasser. Dieses immer mehr zum Werkzeug werdende Ausrüstungsteil ist
auch heute noch in der Yachtsegelei gebräuchlich. Aufgrund der Nutzung
ist bereits seit langem die Bezeichnung Bootshaken gebräuchlich. Auf
diesem Bild ist unten die klassische Ausführung und oben eine moderne
Form abgebildet.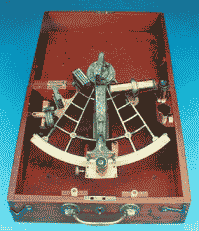
 Sextant:
Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit
einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und
Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links
an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis
Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den
Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man
errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun
Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von
60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der
Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente
wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links
ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer
abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik
der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im
Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der
Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen
hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die
Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel
findet man auf meiner Seite:
Sextant:
Folgerichtig wurde das wichtigste Instrument als erstes gelistet. Mit
einem Sextanten misst der Navigator den Winkel zwischen Horizont und
Sonne, wenn diese ihren höchsten Stand erreicht hat. Der Spiegel (links
an den Bildern zu sehen; Bild /4/) muss so lange gedreht werden, bis
Sonne und Horizont auf einer Linie liegen. Dann kann man den
Einfallswinkel der Sonne auf der unten sichtbaren Skala ablesen und man
errechnet daraus dann den Breitengrad. Und warum heißt der Sextant nun
Sextant? - Weil die gebogene Skaleneinteilung eine Winkelkrümmung von
60° umfasst! Der Sextant wurde 1731 erfunden – eine Revolution in der
Nautik wie ehemals der Kompass. Die dargestellten Instrumente
wiederspiegeln die hohe mechanische Kunst des 19. Jahrhunderts. Links
ein Spiegelsextant, der als ähnliches Gerät rechts im Transportkoffer
abgebildet ist. Beide Bilder zeigen Geräte mit dem Stand der Technik
der Zeit von 1840 bis 1870. Die Geräte waren ca. 23 bis 25 cm im
Durchmesser groß. Sextanten die zur nautischen Ausrüstung der
Schiffsoffiziere gehörten, stellten schon zur damaligen Zeit einen
hohen materiellen Wert dar. Weitere Details zu den Instrumenten und die
Ermittlung der korrekten Position der Lincolninsel
findet man auf meiner Seite:  Fernrohr: Der
Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten
Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele
Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich
beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine
Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.
Fernrohr: Der
Zweck eines Fernrohres ist Jedem klar. Von diesen weit verbreiteten
Geräten, die damals meist als Telescope bezeichnet wurden, gab es viele
Ausführungen. Sehr verbreitet waren Ganzmetallarbeiten. Links zeige ich
beispielhaft eom Telescope aus dem Jahre 1830, eine
Arbeit mit Messingeinschüben und einem Mahagonischaft.
 Großer Kompass
und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die
konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung
meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also
Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.
Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer
Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die
Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So
wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim
Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für
Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass
nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders
geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei
Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte
ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich.
Großer Kompass
und Taschenkompass: Zu den Kompen fehlen leider die
konstruktiv beschreibenden Angaben. So hatte ich bei der Sichtung
meiner umfangreichen Bücher zu diesem Thema die Qual der Wahl. Also
Magnetkompen - die Geschichte des Magnetkompasses geht bis auf das 14.
Jahrhundert zurück. Links zeige ich ein Beispiel einer
Feinmechanikerarbeit um 1850. Gut zu erkennen ist die
Visiereinrichtung, die abklappbar ist. Der Dreifuss ist entfernbar. So
wie im Bild dargestellt, wurde der Kompass zu Peilungen beim
Landeinsatz verwendet. In ähnlicher Form waren aber auch Kompen für
Beiboote und kleinere Segelschiffe gebräuchlich. Dort war der Kompass
nicht fest auf den Booten eingebaut. Dafür hatte man eine besonders
geschützte Stelle in Nähe des Steuermanns baulich vorgesehen. Bei
Landgang wurde der Kompass dann mitgenommen. Aus diesem Grunde halte
ich das von mir ausgesuchte Modell für nicht unwahrscheinlich. 
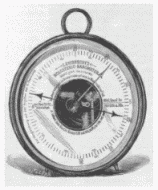 Thermometer: Links ein altes
Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker
benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).
Thermometer: Links ein altes
Wandthermometer mit Reaumur, nach einem französischem Physiker
benannt, und einer Celsius Anzeige (Bildquelle /6/).
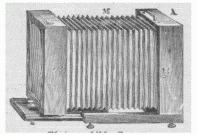 Fotoapparat: Mit dieser kurzen
und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am
plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)
einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem
Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich
vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für
Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den
stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine
interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite
Fotoapparat: Mit dieser kurzen
und knappen Angabe habe ich meine größten Probleme gehabt. Am
plausibelsten schien mir die Wahl (wie rechts, Bildquelle /8/)
einer alten Plattenkamera mit Schiebebalg. Leider ist unserem
Roman nicht zu entnehmen, welche Art von Kamera zum Einsatz kam. Ich
vermute fast, dass ein Schiebebalg nicht unbedingt das Optimale für
Reisen ist. Denn die Kameras der damaligen Zeit waren nur für den
stationären Einsatz geschaffen. Weiterführend habe ich dazu eine
interessante Entwicklung zur „Reisekamera“ auf meiner Seite  KLEIDUNGSSTÜCKE:
KLEIDUNGSSTÜCKE: