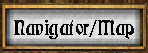|
Buchbeispiele:
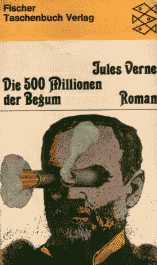
Oben:
Fischer Taschenbuchverlag GmbH, Frankfurt am Main © Verlag Bärmeier
& Nikel, Frankfurt am Main 1967, Band JV 10,
JV10-280-ISBN-3-436-01252-1, neu übersetzt (und gekürzt !!) v. L. Beier
(CF /1801/) - Buch unten: © Verlag Neues Leben, Berlin 1976, 1.
Auflage, L-Nr. 303(305/94/76) CF /1802/
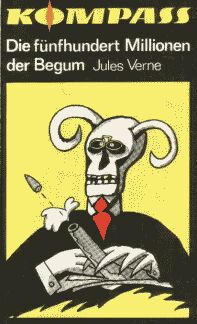

/1/ Bild oben: © Librairie Hachette
Paris; Collection Hetzel /
Les Voyages Extraordinaires Les cinq cents millions de la
Bégum, ca. 1918 (CF /1805/)
/2/ Originalphoto auf Karton: Aufgenommen vom Fotostudio PHOTOGRAPHIE THIEBAULT; 31 Boulevard Bonne Nouvelle, 31, Bildgröße im Original: 6,5 x 10,5 cm, Bild von 1870/71 – CF
/21347/
/3/ Ostwald, Th.: Jules \/erne — Leben und Werk,
Zitat von Seite 136 - Details zur
Unterlage siehe  Quelle /4/
.
Quelle /4/
.
/4/ Bildzitat aus /1/ Seite
133 in Referenz zur
Seite 130 (in der Kasematte)
/5/ Julius Verne: Die fünfhundert Millionen der
Begum Verlag A. Hartleben's Wien Pest Leipzig 1881; Zitat
von Seite 93
/6/ K. K. Österreichisches
Central-Comité der
Weltausstellung zu Paris 1867 (Hrsg.): Bericht über die
Welt-Ausstellung zu Paris im Jahre 1867 (Band 2): Werkzeuge und
Maschinen (IV); Verlag Wilhelm Braumüller, Wien 1869 -
Bildzitat von Seite 453 - Mit freundlicher Genehmigung der
Universitätsbibliothek Heidelberg (Schrb. v. 23.01.2008 Hr. Jens
Dannehl)
/7/ D. Von
Henk: Zur See,
Hamburg 1892, Verlagsanstalt und Druckerei AG; Bildzitat von Seite 65
„Krupp'sche 40 cm Kanone in hoher Rahmenlafette mit hydraulischer
Rücklaufbremse auf dem Schießplatz bei Meppen“
/8/ Giulio Verne I 500 Milioni Della Begum;
Tipografia Editrice Lombarda Milano 1879; CF /1801/ /9/ L'Illustration, Paris vom 17. April 1909 CF/6999/, Bildzitat von Seite 264 (Bildarchiv CF/21302/)
|
Die
500 Millionen der Begum (1879)
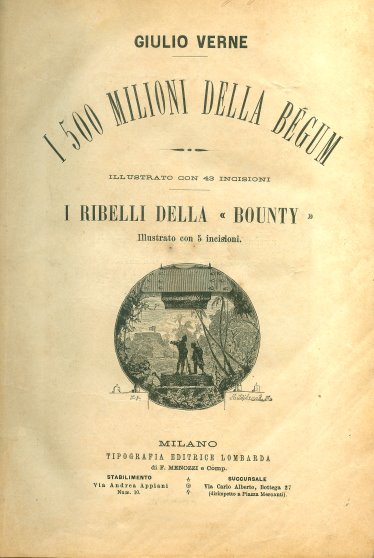 Die Originalausgabe erschien am
18.
September 1879 unter dem Titel Les cinq cents millions de la
Bégum bei Pierre-Jules Hetzel in Paris. Im Anhang befand
sich die Kurzgeschichte Die Originalausgabe erschien am
18.
September 1879 unter dem Titel Les cinq cents millions de la
Bégum bei Pierre-Jules Hetzel in Paris. Im Anhang befand
sich die Kurzgeschichte  Révolté
de la Bounty).
Um nicht immer wieder gleichartige Beispielexemplare meiner Sammlung zu
präsentieren, habe ich diesmal andere Editionen ausgewählt. Rechts die
italienische Erstausgabe, vollillustriert, ebenfalls aus dem Jahre 1879
/8/. Die ersten deutschsprachigen Ausgaben gab es erst in den 80er
Jahren. Der rote Einband ganz links unten ist ein späteres französisches Beispiel
von Hachette im Kleinformat /1/. Révolté
de la Bounty).
Um nicht immer wieder gleichartige Beispielexemplare meiner Sammlung zu
präsentieren, habe ich diesmal andere Editionen ausgewählt. Rechts die
italienische Erstausgabe, vollillustriert, ebenfalls aus dem Jahre 1879
/8/. Die ersten deutschsprachigen Ausgaben gab es erst in den 80er
Jahren. Der rote Einband ganz links unten ist ein späteres französisches Beispiel
von Hachette im Kleinformat /1/.
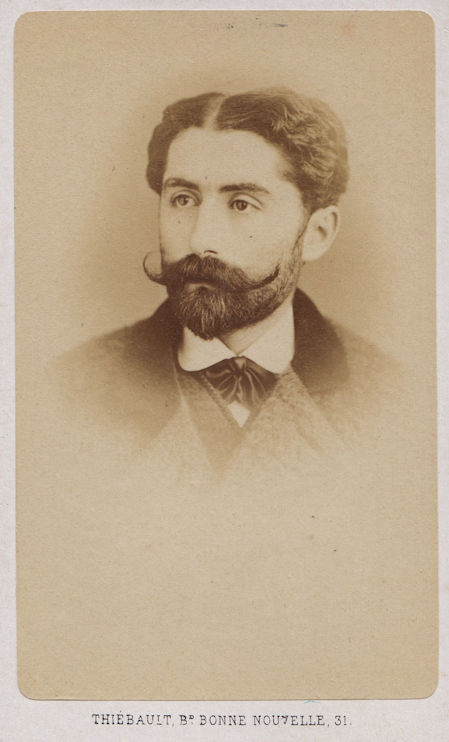 Interessant ist die
Entstehung des Romans. Hetzel kaufte nämlich die
Grundidee des Buches als Manuskript von Paschal Grousset (1844
– 1909) (Siehe Bild links /2/ um 1870/71und weiter unten), der den Künstlernamen André Laurie angenommen hatte. Interessant ist die
Entstehung des Romans. Hetzel kaufte nämlich die
Grundidee des Buches als Manuskript von Paschal Grousset (1844
– 1909) (Siehe Bild links /2/ um 1870/71und weiter unten), der den Künstlernamen André Laurie angenommen hatte.
Ergänzender Hinweis:
Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne
empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.
Unter dem Titel L'Héritage de Langevol
- Das Langevol-Vermächtnis, hatte Grousset die
Auseinandersetzung der von einem Deutschen straff geführten
Industriestadt mit einer französischen Idealstadt, genannt „Hygeia“,
beschrieben. Jules Verne erhielt den Stoff zur Überarbeitung, die dann
noch ziemlich umfangreich war. Eine noch intensivere Nachnutzung von
Materialien Grousset's fand in den Romanen  Der
Stern des Südens (1884) und im Roman Der
Stern des Südens (1884) und im Roman  Das
Wrack der Cynthia
(1885) statt.
Weitere Details sind dort nachzulesen. Nachfolgend Portraits Groussets
/ Lauries um 1875/80 und um 1905. Er starb am 9. April 1909 in Paris.
Die Bilder sind aus seinem Nachruf in der Zeitschrift L'Illustration /9/. Das
Wrack der Cynthia
(1885) statt.
Weitere Details sind dort nachzulesen. Nachfolgend Portraits Groussets
/ Lauries um 1875/80 und um 1905. Er starb am 9. April 1909 in Paris.
Die Bilder sind aus seinem Nachruf in der Zeitschrift L'Illustration /9/.
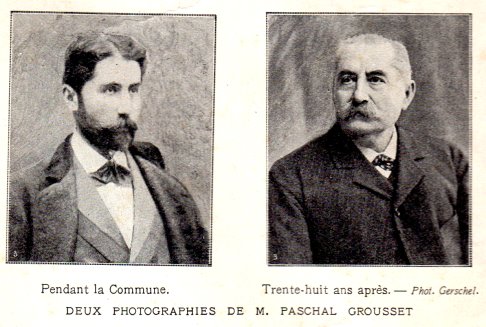 Wie schon mehrfach bei Verne als
Stilmittel genutzt, ist der „Aufhänger“ der Geschichte eine
Erbschaftsangelegenheit. 500 Millionen, das Vermögen einer indischen
Prinzessin, warten auf einen Erben: Als Erbfolger wird der „nette“
französische Arzt Dr. Sarrasin ermittelt, der sein Glück noch gar nicht
fassen kann. Sofort schmiedet er große Pläne: Er möchte mit dem Geld
eine moderne und blühende Stadt, nach streng hygienischen
Gesichtspunkten errichten. Doch plötzlich meldet sich noch jemand, der
Anspruch auf die Millionen erhebt: Es ist der deutsche Professor
Schultze. Auch er ist voller Pläne und auch er will eine Stadt bauen.
Doch diese steht völlig konträr zu den Vorstellungen des anderen Erben:
Schultze baut ein Stahlimperium auf, eine Industrieansiedlung nach
Krupp'schen Muster: Waffenschmiede für Geschütze und Kanonen. Wie schon mehrfach bei Verne als
Stilmittel genutzt, ist der „Aufhänger“ der Geschichte eine
Erbschaftsangelegenheit. 500 Millionen, das Vermögen einer indischen
Prinzessin, warten auf einen Erben: Als Erbfolger wird der „nette“
französische Arzt Dr. Sarrasin ermittelt, der sein Glück noch gar nicht
fassen kann. Sofort schmiedet er große Pläne: Er möchte mit dem Geld
eine moderne und blühende Stadt, nach streng hygienischen
Gesichtspunkten errichten. Doch plötzlich meldet sich noch jemand, der
Anspruch auf die Millionen erhebt: Es ist der deutsche Professor
Schultze. Auch er ist voller Pläne und auch er will eine Stadt bauen.
Doch diese steht völlig konträr zu den Vorstellungen des anderen Erben:
Schultze baut ein Stahlimperium auf, eine Industrieansiedlung nach
Krupp'schen Muster: Waffenschmiede für Geschütze und Kanonen.
Nach
kurzer Zeit sind die Pläne Realität
geworden: Der sauberen und idealisierten Stadt France-Ville steht in
unmittelbarer Nähe der düstere und Unheil verkündende Ort Stahlstadt
gegenüber. Es dauert nicht lange und ein Konflikt bahnt sich an. So
verwundert es auch nicht, als Schultze eine Riesenkanone mit einem
geheimnisvollen Geschoss auf seinen vermeintlichen Gegner richtet - der
Musterstadt droht Gefahr.
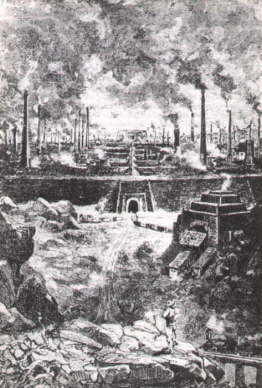 Eine
letzte Chance sieht der junge elsässische Ingenieur Marcel Bruckmann.
Er kann sich in Stahlstadt einschleichen und das Vertrauen des
Professors gewinnen. Doch ihm droht Gefahr, denn der „Vater“ der
Riesenkanone und der Geheimwaffe lässt keinen Mitwisser zu. Doch Marcel
kann heimlich fliehen. Sofort versucht er in France-Ville „Entwarnung“
zu geben – eine direkte Bedrohung durch das Riesengeschoss besteht
nicht – die Flugbahn wurde falsch berechnet. Schultze macht ernst und
läßt France-Ville beschießen. Marcel hatte recht: Der Schuss verfehlt
und geht „in die Luft“. Eine
letzte Chance sieht der junge elsässische Ingenieur Marcel Bruckmann.
Er kann sich in Stahlstadt einschleichen und das Vertrauen des
Professors gewinnen. Doch ihm droht Gefahr, denn der „Vater“ der
Riesenkanone und der Geheimwaffe lässt keinen Mitwisser zu. Doch Marcel
kann heimlich fliehen. Sofort versucht er in France-Ville „Entwarnung“
zu geben – eine direkte Bedrohung durch das Riesengeschoss besteht
nicht – die Flugbahn wurde falsch berechnet. Schultze macht ernst und
läßt France-Ville beschießen. Marcel hatte recht: Der Schuss verfehlt
und geht „in die Luft“.
Kurz
darauf wird es ruhig um Stahlstadt, Gerüchte das Schultze Bankrott ist
kursieren und aus der Stadt kommen keine Lebenszeichen mehr. Als
Bruckmann mit einem Freund das Rätsel lösen will, findet er Schultze
nur noch tot vor. Er hatte ein Geschoss entwickelt, welches keinen
Schaden an Gebäuden anrichten, aber durch eine „Vereisung“ das Leben
auslöschen sollte (die Wirkung erinnerte mich in fataler Weise an die
in den letzten 70er/80er Jahren diskutierte Neutronenbombe). Durch
einen Defekt an der Waffe hatte sich der Erfinder in seiner
Schaltzentrale selbst gerichtet.
Einige
Kritiker sehen in der Schilderung der Stadt von Schultze die
Vorwegnahme einer Beschreibung eines faschistoiden Systems, und
wirklich hat die Szenerie etwas beklemmendes. Dazu trägt auch bestimmt
die ständigen Waffenbedrohung von Schultzes Diktatur und die im Roman
agierenden Typen Arminus und Sigimer bei, die sofort an
spätere Rassenfanatiker und deren installierte Mechanismen der Gewalt
erinnern. „In diesem Roman kommt überdeutlich Vernes Ablehnung
gegenüber dem deutschen Wesen, das er mit dem Militarismus eng
verbindet, zum Ausdruck. Die Wurzel für dieses Verhalten lag sicher in
den Ereignissen des deutsch-französischen Krieges, den Jules Verne ja
aus nächster Nähe erleben mußte.“ /3/
Die
Riesenkanone Schultzes
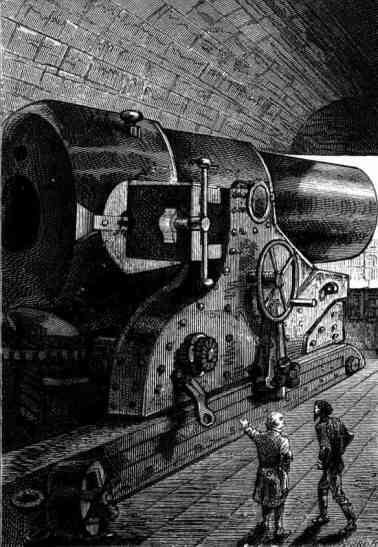 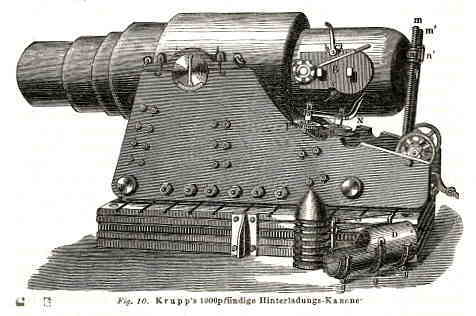 Schultze, der in Marcel
einen potentiellen Mitstreiter sieht, zeigt dem jungen Mann
selbstzufrieden sein Imperium. Schließlich gelangen sie in die so genannte
Kasematte, in der eine riesige Vernichtungswaffe steht. (Bild links
/4/ mit den beiden Personen) „Dieses Granitbauwerk, dessen
Festigkeit auf den ersten Blick einleuchtete, bedeckte eine Art
Kasematte mit mehrfachen Schießscharten. In der Mitte derselben stand
eine ungeheure Kanone aus Gußstahl. »Sehen Sie hier!« sagte der
Professor, der bisher den Mund nicht mehr aufgethan hatte. Es war das
größte Belagerungsgeschütz, das Marcel je gesehen, als Hinterlader
eingerichtet und mindestens 300.000 Kilogramm schwer. Der Durchmesser
seiner Mündung erreichte einundeinhalb Meter. Das Ungethüm mit seiner
auf Rollen laufenden Stahl-Laffete war doch so leicht zu regieren, daß
ein Kind zu seiner Bewegung hingereicht hätte so ausgezeichnet
arbeitete der sinnreiche Mechanismus. Hinter der Laffete hielt eine
gewaltige Feder den Rückstoß des Geschützes auf und diente gleichzeitig
dazu, dasselbe nach jedem Schuß wieder in seine vorige Lage zu bringen.
»Und welche Perforationskraft besitzt dieses Geschütz? fragte Marcel,
den ein solches Meisterstück unwillkürlich in Erstaunen setzte. Auf
zwanzigtausend Meter durchbohren wir mit einem Vollgeschoß eine
vierzigzöllige Platte wie eine Butterschnitte!“ /5/ Schultze, der in Marcel
einen potentiellen Mitstreiter sieht, zeigt dem jungen Mann
selbstzufrieden sein Imperium. Schließlich gelangen sie in die so genannte
Kasematte, in der eine riesige Vernichtungswaffe steht. (Bild links
/4/ mit den beiden Personen) „Dieses Granitbauwerk, dessen
Festigkeit auf den ersten Blick einleuchtete, bedeckte eine Art
Kasematte mit mehrfachen Schießscharten. In der Mitte derselben stand
eine ungeheure Kanone aus Gußstahl. »Sehen Sie hier!« sagte der
Professor, der bisher den Mund nicht mehr aufgethan hatte. Es war das
größte Belagerungsgeschütz, das Marcel je gesehen, als Hinterlader
eingerichtet und mindestens 300.000 Kilogramm schwer. Der Durchmesser
seiner Mündung erreichte einundeinhalb Meter. Das Ungethüm mit seiner
auf Rollen laufenden Stahl-Laffete war doch so leicht zu regieren, daß
ein Kind zu seiner Bewegung hingereicht hätte so ausgezeichnet
arbeitete der sinnreiche Mechanismus. Hinter der Laffete hielt eine
gewaltige Feder den Rückstoß des Geschützes auf und diente gleichzeitig
dazu, dasselbe nach jedem Schuß wieder in seine vorige Lage zu bringen.
»Und welche Perforationskraft besitzt dieses Geschütz? fragte Marcel,
den ein solches Meisterstück unwillkürlich in Erstaunen setzte. Auf
zwanzigtausend Meter durchbohren wir mit einem Vollgeschoß eine
vierzigzöllige Platte wie eine Butterschnitte!“ /5/
Wie
schon einleitend erklärt,
basierte die ursprüngliche Geschichte auf eine Idee von Grousset. Die
ernsthafte Auseinandersetzung der widersprüchlichen Kräfte und die
detailreichen Beschreibungen der Waffensysteme sind Schöpfungen von
Verne. War die o.g. Beschreibung nun aber auch eine Phantasie Vernes?
Die Geschossart, die eine Art Vereisung bewirkte, war eine Idee des Autors. Aber die Dimensionierung der
Kanone hatte fast eine Entsprechung in der Realität. Auf der 1867 in
Paris statt gefundenen Weltausstellung wetteiferten die Nationen um
eine möglichst überzeugende Darstellung der kommerziellen und der
wissenschaftlich-technischen Errungenschaften. Dazu gehörte zum
damaligen Selbstverständnis auch der Wettstreit der Industrienationen,
möglichst gigantische Waffen zum Beweis eigener Stärke auszustellen.
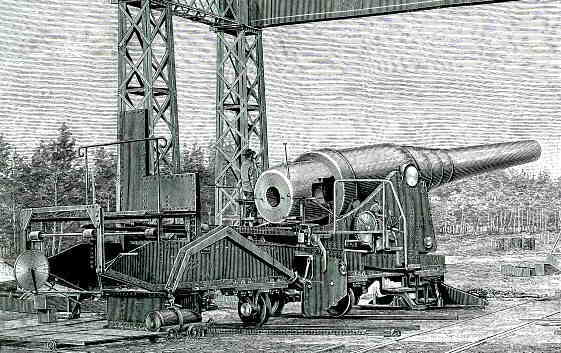 Neben Frankreich und England wurde dies auch von Deutschland
wahrgenommen. Besonders beindruckend war die Ausstellungsfläche von
Krupp, der neben seinen riesigen Schmiedehammern auch moderne
Waffensysteme zur Schau stellte. Dazu links, mit dem fast weißem Hintergrund, ein Bild von der Pariser Weltausstellung 1867 /6/.
Was lag für Verne näher, als bei einer Beschreibung einer Waffe die an
die Entwicklung von Krupp angelehnt sein sollte, eine allgemein
zugängliche Quelle für die Riesenkanone nach Krupp'scher Bauart zu
benutzen? Verne war bekannt für sein Quellenstudium und der Ablage in
seinem riesigen Zettel-Karteikasten-System. So vermute ich, dass die
damaligen Publikationen, denn das „Säbelrasseln“ gehörte zum Umgangston
der Militärs, auch bei ihm Eingang fanden. Details zum Bild der
Weltausstellung /6/: 1.000 pfündige Hinterladungs-Kanone (1.000 ist das
gussstählerne Hohlgeschoss-Gewicht, also 500 Kg) zur Armierung eines
Küsten-Forts mit einem Rohrgewicht inklusive des Verschluss' von
100.000 Pfund, also 50.000 Kg, wobei ich keine Gewichtsangaben zur
Lafette gefunden habe. Die Angaben vom Verne'schen Geschütz a la
Schultze sind aber nicht so illusorisch. So habe ich in einer Quelle
von 1892, also nicht lange nach der Romanentstehung, ein Beispiel
gefunden, welches noch gewaltiger ist. Diesmal ist es ein
Schiffsgeschütz: „... das oben veranschaulichte Krupp'sche 40 cm Rohr
hat eine Gesamtlänge von 10 m und mit dem Gewicht ein 720 000 Kg: das
der Oberlafette beträgt 12 400 kg, das des Rahmens 32.600 Kg. Mit einer
Ladung ..... wird eine Panzergranate von 775 Kg ...“ verschossen.(Bild rechts) /7/.
Rüstung hat schon immer gigantische Steuermittel verschlungen ... und
das mit welchem Ziel? Hoffen wir also, dass in der Realität stets
die France-Ville-Vertreter
die Oberhand behalten. Neben Frankreich und England wurde dies auch von Deutschland
wahrgenommen. Besonders beindruckend war die Ausstellungsfläche von
Krupp, der neben seinen riesigen Schmiedehammern auch moderne
Waffensysteme zur Schau stellte. Dazu links, mit dem fast weißem Hintergrund, ein Bild von der Pariser Weltausstellung 1867 /6/.
Was lag für Verne näher, als bei einer Beschreibung einer Waffe die an
die Entwicklung von Krupp angelehnt sein sollte, eine allgemein
zugängliche Quelle für die Riesenkanone nach Krupp'scher Bauart zu
benutzen? Verne war bekannt für sein Quellenstudium und der Ablage in
seinem riesigen Zettel-Karteikasten-System. So vermute ich, dass die
damaligen Publikationen, denn das „Säbelrasseln“ gehörte zum Umgangston
der Militärs, auch bei ihm Eingang fanden. Details zum Bild der
Weltausstellung /6/: 1.000 pfündige Hinterladungs-Kanone (1.000 ist das
gussstählerne Hohlgeschoss-Gewicht, also 500 Kg) zur Armierung eines
Küsten-Forts mit einem Rohrgewicht inklusive des Verschluss' von
100.000 Pfund, also 50.000 Kg, wobei ich keine Gewichtsangaben zur
Lafette gefunden habe. Die Angaben vom Verne'schen Geschütz a la
Schultze sind aber nicht so illusorisch. So habe ich in einer Quelle
von 1892, also nicht lange nach der Romanentstehung, ein Beispiel
gefunden, welches noch gewaltiger ist. Diesmal ist es ein
Schiffsgeschütz: „... das oben veranschaulichte Krupp'sche 40 cm Rohr
hat eine Gesamtlänge von 10 m und mit dem Gewicht ein 720 000 Kg: das
der Oberlafette beträgt 12 400 kg, das des Rahmens 32.600 Kg. Mit einer
Ladung ..... wird eine Panzergranate von 775 Kg ...“ verschossen.(Bild rechts) /7/.
Rüstung hat schon immer gigantische Steuermittel verschlungen ... und
das mit welchem Ziel? Hoffen wir also, dass in der Realität stets
die France-Ville-Vertreter
die Oberhand behalten.
|
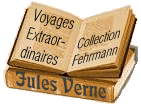
![]()
 zurück
zur Vorseite (RETURN)
zurück
zur Vorseite (RETURN)