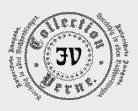
Collection Fehrmann
Jules Vernes Voyages extraordinaires*
Jules Verne - Short Stories (* Dieser Band ist nicht offizieller Bestandteil der VE)
|
|
Collection Fehrmann Jules Vernes Voyages extraordinaires*Jules Verne - Short Stories (* Dieser Band ist nicht offizieller Bestandteil der VE) |
Das Original:
/1/
Musée des Familles,
Vol. 21; Jahrgang 1853-54; Der zweigeteilte Text ist auf den Seiten
193-200 (Ausgabe Vol. 21 Nr. 7 vom April 1854) und den Seiten 225-231
(Vol. 21 Nr. 8 vom Mai 1854) abgedruckt. Die Illustrationen aus
dem Musée des
Familles sind nicht identisch mit den späteren Bildern
aus den Voyages Extraordinaires. CF /6730/
Im deutschsprachigen Raum erschien die Kurzgeschichte unter anderem in diesen Büchern:
oben: Meistererzählungen
Diogenes Verlag AG 1967, 1977, Diogenes Taschenbuch 1977, Auflage 1991,
ISBN 3 257 22416 8; detebe Band 22416 (Diese Auswahl erschien erstmals
1967 unter dem Titel Der
ewige Adam und fünf andere seltsame Erzählungen bei
Diogenes CF /K0301/ - Buch unten: Ein Drama in den Lüften,
Lizenzausgabe des Deutschen Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart
München mit Genehmigung der Diogenes Verlag AG, Zürich; © 1967 by
Diogenes Verlag AG, Zürich; Die deutsche Ausgabe erschien im Diogenes
Verlag unter dem Titel Der
ewige Adam ...; Bücherbundnummer: -05290/2 – CF /K0401/
/2/ Originalfrontispiz oben rechts im Text Le Docteur Ox von 1874 aus Magasin d'Éducation et de Récréation Macé / Stahl / Verne; Paris 1874 20me volume S. 343 – CF/6601/ /3/ Ein Drama in den Lüften, Lizenzausgabe des Deutschen Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart München mit Genehmigung der Diogenes Verlag AG, Zürich; © 1967 by Diogenes Verlag AG, Zürich; Zitat Seite 41 /4/ ebenda, Seite 42 /5/ ebenda, Seite 70 /6/ Illustration aus Verne: Le Docteur Ox, Hetzel & Cie Paris 1875; Les Voyages Extraordinaires; mit 212 Seiten CF /K0205/; Bildzitat von Seite 96 von Th. Schuler /7/ Bildzitat aus /1/ Seite 232 |
Meister Zacharius
(1854, 1874 in Buchform veröffentlicht)
Vor einer nicht näher definierten Zeit, die wahrscheinlich zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert angesiedelt ist, wohnt am Rande des Genfer Sees in der damals noch kleinen Stadt Genf der Uhrmachermeister Zacharius. Sein Haus und die Werkstatt ist auf einer kleinen Rhone-Insel im Zufluss des Sees gebaut, recht abenteuerlich auf schon ziemlich verrotteten Pfählen gegründet. Zacharius, Uhrmacher mit Leib und Seele, hat einige kleinere Erfindungen gemacht, die ihm als Mechaniker einen über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Ruf verschafften. Gerade seine von ihm entwickelte Ankerhemmung brachte ihn eine Anerkennung, die ihn mit Stolz, aber auch mit Überheblichkeit erfüllte. Seine Uhren, die sich durch eine hohe Genauigkeit und Präzision, gepaart mit künstlerischen Anspruch auszeichneten, waren die Grundlage für ein materiell recht abgesichertes Leben.
Er hatte sich eine ganz besondere Philosophie zu eigen gemacht, die er auch seinem Gesellen vermittelte wollte, der aber eine andere Einstellung zur Arbeit hatte als der Meister. So sprach Zacharius zu ihm: „... Du fühlst nicht, dass diese Metalle, die durch meine Genialität zum Leben erweckt wurden, zu pulsieren beginnen wie lebendiges Fleisch! Deshalb würde dich der Tod deiner Werke nicht umbringen, dich nicht!“ /3/ In seiner Verblendung bekannte er Aubert, dass er „.... hinter dem Geheimnis des Lebens gekommen bin (war), hinter der geheimnisvollen Verbindung zwischen Seele und Körper!“ /4/ In weiteren blasphemischen Äußerungen vergleicht er sich zunehmend mit Gott, dem er sich durch seine Arbeit und seinen Schöpfungen zumindest gleichgestellt sieht. Der zur Glaubensfrage erhobene Konflikt zerfrisst zunehmend Zacharius. Als dann auch noch die ersten Kunden kommen, die ihm seine inzwischen allesamt defekten Uhren zurückbringen, sieht er sich von der Welt missverstanden und er leidet zunehmend auch körperlich darunter. In dieser Phase taucht ein sonderbares Männchen auf, skuril beschrieben wie eine vermenschlichte Uhr. Dieses Männchen besuchte den Meister, verfolgte aber selbst unterwegs in der Stadt die Kinder. In welcher Beziehung stand es zu Meister Zacharius? Gérande war zutiefst beunruhigt, zumal das vor sich hin meckernden Männchen auch äußerte: „Gérande wird Aubert nie heiraten!“ Inzwischen schwant der Tochter, dass ihr Vater den rechten Glauben verloren hat. Sie beschließt, neben ihren alltäglichen Gebeten soll auch ein Besuch des Vater in der örtlichen Sankt-Peters-Kirche diesen läutern. Gerade vor diesem Zeitpunkt wurden die letzten vom Meister gebauten Uhren zu ihm zurückgebracht. Die Kunden waren rigoros: Sie verlangten ihr Geld zurück, da die Uhren unbrauchbar waren. So musste er sich im Laufe der Zeit von seinen bescheidenen Wohlstand trennen, Armut kehrte in das Haus ein. Der Tag kam und Gérande konnte ihren Vater zum Kirchenbesuch überreden, war er doch wirklich schon lange nicht mehr beim Gottesdienst gewesen, was natürlich von den Genfer Mitbürgern misstrauisch registriert wurde. Aber Zacharius ist nicht der demütige Kirchgänger. Voller Hochmut bleibt er in der Kirche stehen, die Worte von der Kanzel dringen nicht zu ihm. Da passiert etwas, was den Alten bis in sein Innerstes trifft: Die Kirchenuhr, bis dato noch genau gehend, bleibt in mitten des Gottesdienstes kurz vor zwölf Uhr stehen! Besinnungslos bricht der Greis zusammen. Nach Hause gebracht schwant ihm, das seine Zeit abgelaufen ist. Völlig geschwächt verspricht er Aubert die Hand seiner Tochter. Dann aber bäumt er sich auf. Er will nicht sterben! Einer Ahnung nachgehend durchblättert er seine Auftragsbücher. Alles Uhren wurden zurückgegeben, alle bis auf eine! In einer Art Fieberwahn bildet er sich ein, dass sein Leben an die Existenz dieser Uhr gekoppelt ist. Er muss sie wiederfinden!
Kurz darauf hat er sich aufgerafft und zur Überraschung der jungen Leute ist er verschwunden. Der „Uhrenspur“ im Auftragsbuch folgend, beschließt man dem Alten zu folgen, der offensichtlich zum Aufstellungsort der Uhr, dem Schloss Andermatt unterwegs ist. Hier spielt auch der letzte Akt der Geschichte, der voller düsterer Dramatik beschrieben wird. Als der Alte „fast toll vor Glück“ die noch intakte Uhr findet, will er sich dieser bemächtigen, ist sie doch das Synonym seines Lebens. Dies ist jetzt aber die Stunde des geheimnisvollen Männchens. Es hauste ebenfalls im Schloss und es ist der Besitzer der Uhr! Es kommt noch schlimmer: In diabolischer Manier verspricht das Männchen dem Meister die Uhr. Aber zu welchem Preis! Er fordert Zacharius’s Tochter, um diese zu ehelichen. (siehe Bild rechts, Zacharius mit Tochter /6/) Die Verlobten sind entsetzt! Der schon mehrfach erhobene Zeigefinger Vernes wird nun in der Erzählung besonders deutlich. Die gesuchte Uhr, ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst, wurde so gebaut, dass sie in regelmäßigen Abständen über eine sinnreiche Mechanik fromme Sprüche in einer Anzeige zum Besten gibt. Jetzt erscheinen aber blasphemische Aussprüche, wie zum Beispiel: „Der Mensch kann Gott gleich werden“. „Aubert und Gérande sahen sich verblüfft an. Das waren doch nicht mehr die orthodoxen Devisen eines katholischen Uhrmachers! Da musste schon der Satan mitgespielt haben!“ /5/ Wird dem Leser erst suggeriert, dass sich hinter Pittonaccio, dem wundersamen Männlein die Zeit verbirgt, wird jetzt die Parallele zum Teufel gezogen. Oder wird die Zeit als Teufelswerk angesehen? In einem furiosen Finale zerbirst die Uhr, Pittonaccio verschwand mit einer Gotteslästerung auf den Lippen im Boden und der Meister stirbt (siehe Bild links: Pittonaccio und der Meister in der Originalausgabe des Musee in der Sterbeszene /7/) Nachtrag:
War dies nun eine
katholische Geschichte über die existentielle Gefahr in die sich ein
Mensch begibt, wenn er dem Glauben abtrünnig wird? Irgendwie erinnert
mich der Ansatz der Kurzgeschichte doch an die damals kursierenden
Traktätchen missionierender Weltverbesserer. Sah sich der Katholik
Jules Verne dazu innerlich berufen?
|
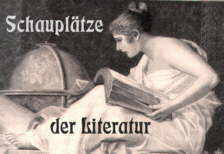 Bei einem Besuch in der Schweiz 2014 machte mich Stephan Bühlmann auf die mögliche geografische Zuordnung des fiktiven Ortes der Kurzgeschichte aufmerksam. Er regte mich dadurch zur Recherche und dem Entstehen des nebenstehenden Beitrages an. Vielen Dank dafür und auch für das Kartonbild einer alten Plattenaufnahme /10/ der historischen Ruine. Weitere Quellenangaben: /8/ Zitat aus /3/ Seite 63 /9/ Zitat aus /3/ Seite 66 /10/ Echte Fotografie Martigny; ca. 1860; Aufnahme und Atelier von AD. Braun aus Dornach am Rhein; CF /21101/ /11/ Jules Verne: Le Docteur Ox; J. Hetzel et Cie Paris 1875; Kurzgeschichte Maitre Zacharius; Illustration von Seite 89 durch Theophile Schuler; CF /1304/ /12/ Meyers Konversations-Lexikon; 14. Band , Leipzig 1878, Collection Fehrmann; Bildzitat von Seite 494 |
Meister
Zacharius - Ein geografisches Puzzle oder: Die Suche nach Schloss Andernatt
Wie sieht es
aber mit der Möglichkeit der geografischen
Zuordnung des finalen Schauplatzes, des Schlosses Andernatt aus? Denn
dorthin
begab sich offenbar Zacharius um seine letzte noch funktionierende Uhr
zu
suchen und das junge Paar Aubert und Gerande wollten ihm folgen. Die Idee, dass
der Ort Andermatt eine Zuordnung möglich
machen könnte, muss man fallen lassen. Andermatt liegt fast 300
Kilometer von
Genf entfernt im Kanton Uri. Aber die Erzählung selbst gibt einen
sachdienlichen Hinweis: „…
Schloss Andernatt befindet sich in den Schluchten
der Dents-du-Midi, zwanzig Wegstunden von Genf entfernt!“
/8/ Es geht also in die
Bergkette der Dents-du-Midi (bei B beginnend). Diese liegt süd-östlich
unter dem
Genfer See, ist
rund 90 Kilometer von Genf entfernt und sie ist der Eingang des Kantons
Wallis.
Der nächste
Hinweis in der Erzählung ist das Dorf
Evionnaz (E), als verlassenes Nest in Mitten der Steinwüste
beschrieben. Auch
dieser Ort ist real existent. Es ist ein Ort an der Rhone liegend,
heute mit
über 1200 Einwohnern. Dies ist der letzte konkrete Hinweis in der
Vorlage. Wenn
man diese südliche Richtung aber weiter verfolgt, dann erscheint ein
Ziel,
welches unserer Suche zu entsprechen scheint, zumal die Erzählung noch
den
Hinweis gibt: „…
und nun tauchte vor ihm eine alte, finstere Ruine auf, die
sich von den Felsen, auf denen sie stand, kaum mehr unterschied.“/9/ Denn nur 10
Kilometer weiter südlich liegt die Burg La
Bâtiaz (französisch Château de la Bâtiaz) – sie ist die Ruine einer
Höhenburg,
in Martigny (F) liegend. Schon im Jahre 1518 wurde sie niedergebrannt,
war aber
bereits vor 150 Jahren ein romantisches Ausflugsziel in Wallis. Siehe
dazu das Bild
links oben im Text /10/. Wenn man dann noch vergleichend die in der Erzählung eingebettete Originalillustration /11/ (Stich weiter oben rechts) betrachtet, sie zeigt die Akteure auf den Weg zum Schloss, dann scheint die Zuordnung statthaft zu sein. Die reale Vorlage zum Schloss Andernatt ist gefunden. Unten noch eine kleine Übersicht zu den beschriebenen Örtlichkeiten /12/:
|
|
FILM 1
|
|
|
FILM 2
|
![]()
|
|
Hinweis: Beschrieben werden nur in meiner Sammlung befindliche Bücher und Verfilmungen. Dargestellte Bücher sind Beispiele daraus. |
|
© Andreas Fehrmann 03/04, letzte Aktualisierung 19. November 2020