|
 verne_technik02.html verne_technik02.html
Jules
Verne Zitate sind rechts im Text wie gewohnt in blau
dargestellt.
Quellenangaben,
und vielleicht der Reiz etwas mehr darüber zu lesen? (Die
Systematisierung bezieht sich nur auf die Nutzung für diesen Beitrag)
/1/ Dr.
Max Popp: Julius
Verne und sein Werk 1909 © Fabri Verlag Ulm für die
Ausgabe als Faksimile Reprint 1999 - ISBN 3-931997-08-1, Zitat von
Seite 10 (CF /5503/), Zitat von Seite 133
/2.1/
Jules Verne 20.000
Meilen unter den Meeren; zitiert aus Fischer
Taschenbuchverlag Frankfurt am Main, 1997; Seite 131
/2.2/
ebenso, Seite 138
/3/
Jules Verne: Paris
im 20. Jahrhundert; Paul Zsolnay Verlag Wien 1996; S. 26
/4/
Walter Häntschel: Die
Praxis des modernen Maschinenbaus, Verlag C.A. Weller
1919, Band II, Seite 373
/5/
Jules Verne: Robur
der Sieger / Der Herr der Welt; Doppelband; Verlag Neues
Leben 1986; Seite 39
/6/
ebenso, Seite. 130
/7/
Jules Verne: Die
Insel der Milliardäre, Diogenes Verlag AG Zürich 1985;
Seite 83 und 84
/8/
Wilfried Feldenkirchen: 150
Jahre Siemens; Siemensforum München 19975, Seite 13
/9/
Jules Verne: Mathias
Sandorf Teil 1; Deutscher Bücherbund GmbH & Co
Stuttgart München, 1979; Seite 195
/10/
Jules Verne: Die
Erfindung des Verderbens; Verlag Neues Leben 1982; Seite 87
/11/
Dr. Heinrich Samter: Das
Reich der Erfindungen 1901; Reprintausgabe Gondrom Verlag
GmbH, Bindlach 1998; Seite 240
Alle Quellen aus Collection Fehrmann.
Bemerkungen zu den Bildern:
#1# Was hat der Illustrator Riou in der
Maschinenhalle eigentlich dargestellt? Er verknüpfte unterschiedlichste
Elemente der Technik miteinander. So finden wir: Zahnräder die im
Uhrenbau üblich sind (Großes Rad, untypisch für Maschinenbau), eine
elektrische Spule, Tragelemente, Kessel mit Ventilen. Denn wie sollte
er sich eine überdimensionierte Batterieanlage vorstellen? Siehe dazu
ergänzend das Bild darunter: Druckluftkessel um 1900 (spiegelverkehrt)
aus /4/
#2# Und was sehen wir auf der Illustration von L.
Bennett in der Fabrik? Es handelt sich um eine
Zweifach-Expansions-Dampfmaschine. Diese riesigen Maschinen (wie zu
erkennen über mehrere Stockwerke gebaut) sind in den 90er Jahren des
19. JH typisch für den Antrieb der aufkommenden Elektrizitätswerke
gewesen. Siehe vergleichend dazu das Bild darunter: Prinzipieller
Aufbau der Maschine (aus Bildatlas zu /4/).
|
Beginnen wir wie
im Kapitel I der Technikgeschichte Vernes wieder mit dem Zitat von Max
Popp: „Verne war der Ansicht, dass man mit Hilfe der Elektrizität
einfach alles zu leisten imstande ist, was der Mensch nur auszudenken
vermag.“/1/ Diese These wollen wir uns nun unter dem nächsten
Gesichtspunkt ansehen:
MOBILIS IN MOBILI oder die Suche nach dem
idealen Antrieb
In seinen Voyages Extraordinaires,
oder Reiseromanen
wie sie früher im deutschsprachigen Raum genannt wurden, geht es
natürlich oft um die Fragen der Fortbewegung. Konsequent nutzen die
Helden Vernes alle damalig verfügbaren Möglichkeiten: Segel- und
Dampfschiff, die Eisenbahn und ganz beliebt bei ihm: Der Ballon und
ergänzend, das Luftschiff. Aber in diesem Kapitel wollen wir uns nicht
der Art des Fortbewegungsmittels, sonder vor allem der Frage des
Antriebs dieser, vor allem seiner fiktiven Maschinen, zuwenden.
In seinen ehedem
unveröffentlichetem Roman  Paris
im 20. Jahrhundert
schildert Verne schon 1863 verschiedene, damals unübliche
Antriebssysteme. So lernen wir die in Röhren mit Pressluft, ähnlich
einer Rohrpostanlage, funktionierende Stadtbahnanlage der Pariser
doppelgleisigen Ringbahn kennen. Eine andere Variante stellt er für
straßengebundene Motorwagen vor: Der Gasverbrennungsmotor von Lenoir.
Dadurch nennt er die Fahrzeuge (in der deutschen Übersetzung)
„Gas-Cabs“. Neben dem Prinzip ist auch der Brennstoff interessant: „Der
wichtigste Vorteil dieser 1859 erfundenen Maschine bestand darin, dass
sie Kessel, Feuerstelle und Brennstoff abschaffte; eine kleine Menge
Leuchtgas, das mit Luft vermischt, unter den Kolben gleitet und durch
einen elektrischen Funken entzündet wurde, erzeugte die Bewegung; an
den verschiedenen Wagenstationen errichtete Gassäulen lieferten den
notwendigen Wasserstoff; jüngste Weiterentwicklungen hatten das Wasser,
welches eins dazu diente, den Zylinder der Maschine abzukühlen,
überflüssig gemacht.“ /3/ Dies ist wieder
eine Beispiel Vernes, wie er ein vorhandenes Prinzip aufnimmt und in
seinen Gedanken breitenwirksam umsetzt. Dabei beschreibt er quasi
nebenbei die Funktion einer Tankstelle, die es ja 1863 nicht einmal in
der Ahnung gab – wozu auch. Interessant ist, dass es aktuell
Bestrebungen gibt, ein flächendeckendes System von
Flüssiggas-Tankstellen zu errichten. Aber schauen wir uns diese
Fahrzeuge der Phantasie Vernes etwas näher an: „Diese/r
war also einfach konstruiert und leicht zu handhaben; der auf seinen
Sitz thronende Maschinist lenkte ein Steuerrad; ein unter seinem Fuß
liegendes Pedal erlaubte es ihm, die Gangart des Fahrzeugs
augenblicklich zu verändern.“ /3/
Neuzeitliche Maschinisten sollten darauf achten, dass die Gangart ihrer
Fahrzeuge immer den Straßenverkehrsvorschriften angepasst ist! Paris
im 20. Jahrhundert
schildert Verne schon 1863 verschiedene, damals unübliche
Antriebssysteme. So lernen wir die in Röhren mit Pressluft, ähnlich
einer Rohrpostanlage, funktionierende Stadtbahnanlage der Pariser
doppelgleisigen Ringbahn kennen. Eine andere Variante stellt er für
straßengebundene Motorwagen vor: Der Gasverbrennungsmotor von Lenoir.
Dadurch nennt er die Fahrzeuge (in der deutschen Übersetzung)
„Gas-Cabs“. Neben dem Prinzip ist auch der Brennstoff interessant: „Der
wichtigste Vorteil dieser 1859 erfundenen Maschine bestand darin, dass
sie Kessel, Feuerstelle und Brennstoff abschaffte; eine kleine Menge
Leuchtgas, das mit Luft vermischt, unter den Kolben gleitet und durch
einen elektrischen Funken entzündet wurde, erzeugte die Bewegung; an
den verschiedenen Wagenstationen errichtete Gassäulen lieferten den
notwendigen Wasserstoff; jüngste Weiterentwicklungen hatten das Wasser,
welches eins dazu diente, den Zylinder der Maschine abzukühlen,
überflüssig gemacht.“ /3/ Dies ist wieder
eine Beispiel Vernes, wie er ein vorhandenes Prinzip aufnimmt und in
seinen Gedanken breitenwirksam umsetzt. Dabei beschreibt er quasi
nebenbei die Funktion einer Tankstelle, die es ja 1863 nicht einmal in
der Ahnung gab – wozu auch. Interessant ist, dass es aktuell
Bestrebungen gibt, ein flächendeckendes System von
Flüssiggas-Tankstellen zu errichten. Aber schauen wir uns diese
Fahrzeuge der Phantasie Vernes etwas näher an: „Diese/r
war also einfach konstruiert und leicht zu handhaben; der auf seinen
Sitz thronende Maschinist lenkte ein Steuerrad; ein unter seinem Fuß
liegendes Pedal erlaubte es ihm, die Gangart des Fahrzeugs
augenblicklich zu verändern.“ /3/
Neuzeitliche Maschinisten sollten darauf achten, dass die Gangart ihrer
Fahrzeuge immer den Straßenverkehrsvorschriften angepasst ist!
Vielleicht noch eine Ergänzung aus
der Technikgeschichte: Der kontinuierlich laufende und praxistaugliche
Gasmotor hat einen anderen uns allseits bekannten geistigen Vater: „Die
Erfindung des Gasmotors ist dem Kaufmann R. A. Otto zuzuschreiben, der
sich durch Selbststudium genügend Kenntnisse angeeignet hatte, um an
die Lösung des Problems der Gasmaschine heranzutreten.“ /4/
Ein paar Jahre später, nämlich 1869
und 1870, kamen die drei Bände  20.000
Meilen unter den Meeren
heraus. In diesem Roman läßt Verne seiner technischen Phantasie freien
Lauf. Nachfolgend wollen wir uns aber in diesem Beitrag nur der Frage
des Antriebs des U-Bootes zuwenden. Revolutionär war der
Gedanke, die Nautilus komplett mit allen Segnungen der
Elektroenergie auszurüsten. Mit seiner immensen Vorstellungskraft
gestaltete er damit vor den Augen seiner Leserschar die „Wunder der
Nautilus“. Was könnte Verne zu diesem Gedanken initiiert haben? Wie so
oft, gibt es auch auf diesem Gebiet Anregungen, die er aufgreifen
konnte, aber praktische Anwendungen fehlten weitestgehend. Nachfolgend
will ich vor allem den Stand der Technik aufzeigen, in wie weit Verne
davon profitiert hat, kann und will ich nicht nachweisen. Aber zwischen
Roman und Realität ergeben sich interessante Vergleiche.verne_technik02.html 20.000
Meilen unter den Meeren
heraus. In diesem Roman läßt Verne seiner technischen Phantasie freien
Lauf. Nachfolgend wollen wir uns aber in diesem Beitrag nur der Frage
des Antriebs des U-Bootes zuwenden. Revolutionär war der
Gedanke, die Nautilus komplett mit allen Segnungen der
Elektroenergie auszurüsten. Mit seiner immensen Vorstellungskraft
gestaltete er damit vor den Augen seiner Leserschar die „Wunder der
Nautilus“. Was könnte Verne zu diesem Gedanken initiiert haben? Wie so
oft, gibt es auch auf diesem Gebiet Anregungen, die er aufgreifen
konnte, aber praktische Anwendungen fehlten weitestgehend. Nachfolgend
will ich vor allem den Stand der Technik aufzeigen, in wie weit Verne
davon profitiert hat, kann und will ich nicht nachweisen. Aber zwischen
Roman und Realität ergeben sich interessante Vergleiche.verne_technik02.html
Vielleicht erscheint das Hauptziel
der Entwicklung der Elektrotechnik des 19. Jahrhunderts dem technischen
„NUR-Anwender“ etwas kurios. So wurde vor allem an einer
leistungsfähigen Großmaschine zur Stromerzeugung geforscht, aber diese
sollte nicht zum Generationswechsel des „Riesen Dampf“ in der
Antriebstechnik genutzt werden, sondern schwerpunktmäßig wurde eine
Stromquelle vor allem für die sich rasch verbreitende elektrische
Beleuchtung gesucht (siehe dazu  Jules
Verne und die Elektrizität: Die Beleuchtung).
Dies ist mit einer der Gründe, warum viele wegweisende, aus heutiger
Sicht praktische Erfindungen, etwas unbeachteter blieben. Der in Sankt
Petersburg lebende deutsche Physiker Moritz Herrman Jacobi
(1801-1875) entwickelte 1838 einen mit galvanischen Elementen
fremderregten Elektromotor. Jules
Verne und die Elektrizität: Die Beleuchtung).
Dies ist mit einer der Gründe, warum viele wegweisende, aus heutiger
Sicht praktische Erfindungen, etwas unbeachteter blieben. Der in Sankt
Petersburg lebende deutsche Physiker Moritz Herrman Jacobi
(1801-1875) entwickelte 1838 einen mit galvanischen Elementen
fremderregten Elektromotor.
Hinweis an dieser Stelle:
Für die Recherche von weiteren Personen im Umfeld von Jules Verne
empfehle ich das  Personenregister dieser Domain. Personenregister dieser Domain.
Und eine der ersten praktischen
Anwendungen? Er baute ein 24 Fuß langes Boot, mit dessen Elektroantrieb
er mit vierzehn Personen auf der Newa fahren konnte. Die Kraft des
Motors trieb ein Schaufelrad. Den Motor dürfen wir uns aber nicht als
einen in der heutigen Bauform bekannten Mechanismus vorstellen. Er
bestand aus vier festen und vier drehbaren Elektromagneten. „Die festen
waren die Feldmagnete, die beweglichen bildeten den Anker und der
Strom, welcher die Fahrbewegung hervorbrachte, er ward natürlich aus
einer Batterie entnommen.“ /11/. Als Energiequelle nutzte er mehrere
Grove-Elemente. Diese nach dem Engländer Sir William Robert Grove
benannte Elemente (dessen Idee heute in der
Brennstoff-Zellentechnologie eine Renaissance erfährt) stellte eine
völlig neue Idee der Energieerzeugung dar, denn seine Zellen waren eine
Umkehr der Elektrolyse. Da die ersten Grove-Elemente allerdings Platin
„opferten“, waren sie unrentabel und mit der 1867 von Werner Siemens
gemachten Entdeckung des Dynamos (dafür wurde er später geadelt),
bestand auch kein Bedarf mehr an dieser Technik. Das gleiche Schicksal
wurde vielen anderen Elektro-Batterie- und -Elemente-Systemen zuteil.
Und derer gab es viele, denn wie gesagt, nach der universellen
Elektro-Energiequelle wurde fieberhaft gesucht...
Das von Siemens entdeckte
dynamoelektrische Prinzip stellte dann in Folge auch die Basis der von
mehreren Technikern neu entwickelten Elektromotore dar. Aber der
überall präsente Dampfantrieb, mit seinen riesigen Transmissionen in
den Werkhallen, verzögerte den Siegeszug des Elektromotors. Erst Jahre
später kam es zu ersten praktischen Anwendungen: So gab es „1879 die
erste elektrische (Schau-)Eisenbahn auf der Berliner Gewerbeausstellung
.., 1881 die erste elektrische Straßenbahn der Welt in
Berlin-Lichterfelde“ /8/. Erst nach und nach kam es zu Anwendungen in
der Industrie.
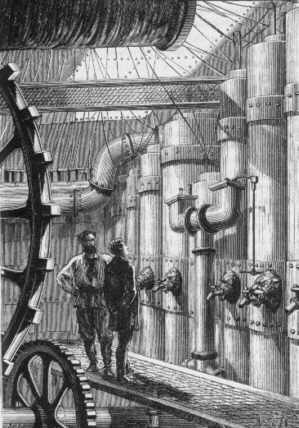 Warum dieser umfangreiche Exkurs?
Erst jetzt können wir die Ideen Vernes besser einordnen. Begeben wir
uns also auf die Nautilus. Das Antriebssystem wird im Kapitel XII
sinnigerweise unter dem Titel „Die Segnungen der Elektrizität“
beschrieben. Ich denke dieser Titel wiederspiegelt zutiefst die
Überzeugung Vernes. Denn wie lässt er Nemo sprechen: „Es gibt eine mächtige, leicht zu
beherrschende und jederzeit verfügbare Energie, die sich für alle
Zwecke einsetzen lässt und das Leben hier an Bord bestimmt. Sie erfüllt
alle Bedürfnisse, sorgt dafür, dass ich Licht habe, dass mir warm ist
und dass meine mechanischen Geräte funktionieren. Diese Energie ist die
Elektrizität.“ /2.1/. Die Philosophie der Stromerzeugung
liest sich dafür etwas komplizierter. Vereinfacht von mir
wiedergegeben: Dem Meerwasser wird Natrium entzogen, dass dann mit
Quecksilber in einem Bunsenelement Strom erzeugt. Diese
Natriumbatterien sollen laut Beschreibung sehr effektiv sein. Da es
sehr aufwendig ist Natrium zu gewinnen, geschieht dies extern von der
Nautilus in einem Stützpunkt im Innern eines Kraters. Als eigentliche
Quelle der Energie, nämlich für die benötigte Hitze der
„Meerwasserentsalzung“, dient unter Wasser abgebaute Steinkohle. Aber
wieder zurück zum Antriebsprinzip: „Von
den Bunsenelementen braucht man nicht so viele, sie sind stark und
groß, was nach meinen Erfahrungen vorteilhafter ist. Der gewonnene
Strom fließt nach hinten, wo er über mächtige Elektromagnete auf ein
eigens konzipiertes System von Hebeln und Zahnrädern wirkt, das dann
die Bewegung auf die Schraubenwelle überträgt.“ /2.2/
(Bild aus gleicher Quelle: „Die hell erleuchtete Maschinenhalle“, Bild
darunter siehe dazu Bemerkung #1# am linken Seitenrand) Warum dieser umfangreiche Exkurs?
Erst jetzt können wir die Ideen Vernes besser einordnen. Begeben wir
uns also auf die Nautilus. Das Antriebssystem wird im Kapitel XII
sinnigerweise unter dem Titel „Die Segnungen der Elektrizität“
beschrieben. Ich denke dieser Titel wiederspiegelt zutiefst die
Überzeugung Vernes. Denn wie lässt er Nemo sprechen: „Es gibt eine mächtige, leicht zu
beherrschende und jederzeit verfügbare Energie, die sich für alle
Zwecke einsetzen lässt und das Leben hier an Bord bestimmt. Sie erfüllt
alle Bedürfnisse, sorgt dafür, dass ich Licht habe, dass mir warm ist
und dass meine mechanischen Geräte funktionieren. Diese Energie ist die
Elektrizität.“ /2.1/. Die Philosophie der Stromerzeugung
liest sich dafür etwas komplizierter. Vereinfacht von mir
wiedergegeben: Dem Meerwasser wird Natrium entzogen, dass dann mit
Quecksilber in einem Bunsenelement Strom erzeugt. Diese
Natriumbatterien sollen laut Beschreibung sehr effektiv sein. Da es
sehr aufwendig ist Natrium zu gewinnen, geschieht dies extern von der
Nautilus in einem Stützpunkt im Innern eines Kraters. Als eigentliche
Quelle der Energie, nämlich für die benötigte Hitze der
„Meerwasserentsalzung“, dient unter Wasser abgebaute Steinkohle. Aber
wieder zurück zum Antriebsprinzip: „Von
den Bunsenelementen braucht man nicht so viele, sie sind stark und
groß, was nach meinen Erfahrungen vorteilhafter ist. Der gewonnene
Strom fließt nach hinten, wo er über mächtige Elektromagnete auf ein
eigens konzipiertes System von Hebeln und Zahnrädern wirkt, das dann
die Bewegung auf die Schraubenwelle überträgt.“ /2.2/
(Bild aus gleicher Quelle: „Die hell erleuchtete Maschinenhalle“, Bild
darunter siehe dazu Bemerkung #1# am linken Seitenrand)
Aber kurz nach der Veröffentlichung
Vernes gab es einen praktischen Nachweis der beschriebenen
Funktionalität „fast vor der Haustür“: „So war das Boot, welches Trouvé
auf der Pariser Ausstellung 1871 betrieb, mit einer Bunsenschen
Batterie von 12 großen Elementen versehen, die zusammen 94 Kilogramm
wogen. Zwei Kabel dienten dazu, den Strom an den Schraubenmotor zu
senden und zugleich das Steuerruder zu regieren.“ /11 ebenda/ 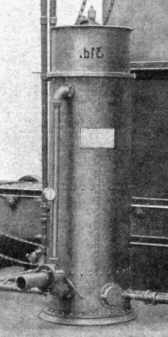 Verne benötigt für sein Boot eine
unter Wasser arbeitsfähige Antriebskraft. Richtig erkennt er, dass die
Elektrizität dafür ideal geeignet ist. Während spätere U-Boote ihre
Akkuanlagen für die Unterwasserfahrt mit Schiffsdiesel bei
Überwasserfahrt aufladen, entscheidet er sich naheliegend für
idealisierte Batterien, deren Energienachschub extern erzeugt wird. Was
aber tun, wenn es noch keinen praxistauglichen E-Motor gibt? Oder wenn
einem die Wirkungsweise der Versuche der Techniker verschlossen bleibt?
In Anlehnung der Arbeitsweise von Dampfmaschinen wird ein System von
Hebeln und Zahnrädern (z.B. Exenter- und Kurbel- oder Planetengetriebe)
mit Elektromagneten beschrieben. Aber nicht die Umsetzung ist das
geniale des Gedankens, sondern die Prophezeihung, dass der elektrische
Strom eine ideale Antriebskraft darstellt! Wie oben erläutert, stand
zum Erscheinen des Buches in der Praxis diese Frage gar nicht zur
Debatte. Dabei geht er sogar noch einen Schritt weiter: Konsequent in
der Anwendung des Stroms beschreibt er auf der Nautilus das Spektrum
von Antrieb, Beleuchtung, elektrischer Uhr, elektrische
Geschwindigkeitsmessung (Elektro-Log), Elektroherd, elektrische
Destillation und Warmwasseraufbereitung. Denn in den Badezimmern kann
man an den Hähnen Kalt- und elektrisch aufgeheiztes Warmwasser
entnehmen! Man stelle sich diesen Luxus zum damalig gebräuchlichen
Standard, selbst in gutbürgerlichen Häusern, vor. Diese Bandbreite der
Anwendungen halte ich persönlich für eine der wirklich „seherischen“
Gaben des Schriftstellers. Verne benötigt für sein Boot eine
unter Wasser arbeitsfähige Antriebskraft. Richtig erkennt er, dass die
Elektrizität dafür ideal geeignet ist. Während spätere U-Boote ihre
Akkuanlagen für die Unterwasserfahrt mit Schiffsdiesel bei
Überwasserfahrt aufladen, entscheidet er sich naheliegend für
idealisierte Batterien, deren Energienachschub extern erzeugt wird. Was
aber tun, wenn es noch keinen praxistauglichen E-Motor gibt? Oder wenn
einem die Wirkungsweise der Versuche der Techniker verschlossen bleibt?
In Anlehnung der Arbeitsweise von Dampfmaschinen wird ein System von
Hebeln und Zahnrädern (z.B. Exenter- und Kurbel- oder Planetengetriebe)
mit Elektromagneten beschrieben. Aber nicht die Umsetzung ist das
geniale des Gedankens, sondern die Prophezeihung, dass der elektrische
Strom eine ideale Antriebskraft darstellt! Wie oben erläutert, stand
zum Erscheinen des Buches in der Praxis diese Frage gar nicht zur
Debatte. Dabei geht er sogar noch einen Schritt weiter: Konsequent in
der Anwendung des Stroms beschreibt er auf der Nautilus das Spektrum
von Antrieb, Beleuchtung, elektrischer Uhr, elektrische
Geschwindigkeitsmessung (Elektro-Log), Elektroherd, elektrische
Destillation und Warmwasseraufbereitung. Denn in den Badezimmern kann
man an den Hähnen Kalt- und elektrisch aufgeheiztes Warmwasser
entnehmen! Man stelle sich diesen Luxus zum damalig gebräuchlichen
Standard, selbst in gutbürgerlichen Häusern, vor. Diese Bandbreite der
Anwendungen halte ich persönlich für eine der wirklich „seherischen“
Gaben des Schriftstellers.
Im Roman „Mathias Sandorf“,
erstveröffentlicht 1885, werden uns die Schnellboote des Doktor
Antekirrt vorgestellt. Während sie äußerlich den spindelförmigen,
vollgedeckten Schnellbooten der Thornycroft-Werft ähneln, haben sie
doch ein anderes Innenleben. „Doch
in einem wichtigen Punkt unterschied sich Doktor Antekirrts Boot von
den Thornycroft-Schiffen: Während jene mit überhitztem Wasserdampf als
Antriebskraft arbeiteten, nutzte er die Elektrizität. Er speicherte sie
in mächtigen Akkumulatoren, die er selbst konstruiert hatte und die
seine Schnellboote mit nahezu unbegrenzter Energie versorgten. Die
Fahrzeuge trugen sogar den Namen ihrer wunderbaren Energiequelle: Sie
hießen alle >Electric< und waren nur zusätzlich
nummeriert.“ /9/. Verne bleibt bei seiner schon in „20000
Meilen unter den Meeren“ gefundenen Lösung, greift aber auf nicht näher
definierte Batterien zurück. Seine Begeisterung für diese Energiequelle
wiederspiegelt sich auch in der Namensgebung, wie wir dem Zitat
entnehmen können. Alle weiteren Details einschließlich Bildmaterial zu
diesen Schiffen sind auf meiner Seite:  Fahrzeuge:
Die Schnellboote ELECTRIC
zu finden. Fahrzeuge:
Die Schnellboote ELECTRIC
zu finden. Als er
sich elf Jahre später im Roman „Die Erfindung des Verderbens“ wiederum
eines schnellen und „kräftigen“ Bootes bedient, kommt der Ansatz erneut
zum Tragen: Als sich der Ingenieur Simon Hart, der durch den Seeräuber
Ker Karraje inkognito als Pfleger Gaydon zusammen mit dem Erfinder Roch
auf einem Segelschiff entführt wird, über die Schnelligkeit des
Schiffes wundert, lesen wir kurz darauf: „Jetzt
endlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen, jetzt endlich begreife
ich, wie der Schoner vorwärts gekommen ist. Ohne Segel, ohne Maschine.
Denn nun taucht der unermüdliche Schlepper auf, der die
>Ebba< gezogen hat. Nun schwimmt er an ihrer Seite. Es
ist ein Unterseeboot, wahrscheinlich durch elektrische Batterien
betrieben!“ /10/. In späteren Passagen wird zwar noch die
Entstehungsgeschichte des Bootes erläutert, der Antrieb selbst bleibt
aber nebulös. 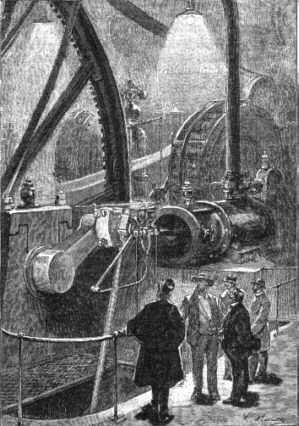 Um 1895 waren die Grundlagen der
Elektrotechnik mit den Systemen der Energieerzeugung, -verteilung und
-nutzung schon relativ ausgereift. In seinem zu dieser zeit
erschienenen Roman Um 1895 waren die Grundlagen der
Elektrotechnik mit den Systemen der Energieerzeugung, -verteilung und
-nutzung schon relativ ausgereift. In seinem zu dieser zeit
erschienenen Roman  Die
Propellerinsel greift er also auf vertrautere
„Komponenten“ zurück, als er deren Antriebssystem beschreibt: „Glücklicherweise aber hatte zu dieser Zeit
die Forschung schon solche Fortschritte erzielt, dass den
Einsatzmöglichkeiten der Elektrizität, dieser Seele des Universums,
keine Grenzen gesetzt waren. Also entschied man sich, die Inseln
mittels elektrischer Energie fortzubewegen. Zwei Fabriken reichten aus,
um Dynamos von praktisch unbegrenzter Leistungsfähigkeit zu betreiben,
die Gleichstrom unter der relativ geringen Spannung von 2000 Volt
erzeugten und damit ein gewaltiges System von Schiffsschrauben in der
Nähe der beiden Häfen (die Seiten an den schwimmenden
Pontons – Anm. d. A.) antrieben.
Dank hunderter von Heizkesseln – die mit Erdölbriketts anstatt
Steinkohle beheizt wurden“ ... “entwickelte
jeder Dynamo eine Leistung von fünf Millionen PS.“/7/
(Bild rechts aus /7/: „Eine der beiden Fabriken“; Bild darunter siehe
dazu Bemerkung #2# am linken Seitenrand) Folgerichtig setzt er die
jetzt inzwischen bekannten Entwicklungen der Elektrotechnik ein. Die
Propellerinsel greift er also auf vertrautere
„Komponenten“ zurück, als er deren Antriebssystem beschreibt: „Glücklicherweise aber hatte zu dieser Zeit
die Forschung schon solche Fortschritte erzielt, dass den
Einsatzmöglichkeiten der Elektrizität, dieser Seele des Universums,
keine Grenzen gesetzt waren. Also entschied man sich, die Inseln
mittels elektrischer Energie fortzubewegen. Zwei Fabriken reichten aus,
um Dynamos von praktisch unbegrenzter Leistungsfähigkeit zu betreiben,
die Gleichstrom unter der relativ geringen Spannung von 2000 Volt
erzeugten und damit ein gewaltiges System von Schiffsschrauben in der
Nähe der beiden Häfen (die Seiten an den schwimmenden
Pontons – Anm. d. A.) antrieben.
Dank hunderter von Heizkesseln – die mit Erdölbriketts anstatt
Steinkohle beheizt wurden“ ... “entwickelte
jeder Dynamo eine Leistung von fünf Millionen PS.“/7/
(Bild rechts aus /7/: „Eine der beiden Fabriken“; Bild darunter siehe
dazu Bemerkung #2# am linken Seitenrand) Folgerichtig setzt er die
jetzt inzwischen bekannten Entwicklungen der Elektrotechnik ein.
Also nichts Neues? Doch – denn
früher war es üblich, dass Schiffsantriebe, zuerst Dampfmaschinen,
später auch Schweröl- und Dieselmaschinen, direkt auf die Welle der
Schraube ihre Kraft übertrugen. Die Schiffsschraube war sozusagen
direkt an die Maschine gekoppelt. 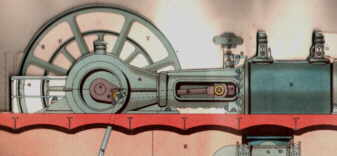 Ausnahmen bildeten nur die mit
Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten U-Boote, die wie weiter oben
schon beschrieben, dieselelektrische Antriebe bekamen. Heutzutage
nutzen moderne Schiffsantriebe das schon damals von Verne beschriebene
Prinzip der Entkopplung von Energieerzeugung und Schiffsantrieb.
Dieselgeneratoren erzeugen in sogenannten Maschinen-Generator-Sätzen
Strom, der dann durch den Einsatz von Umrichtern mit einer eleganten
Drehzahlregelung den elektrischen Antrieb ermöglicht. Eine schnelle
Trennung oder Abschaltung der Schiffsschraube/n ist dadurch ebenfalls
möglich. Ausnahmen bildeten nur die mit
Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten U-Boote, die wie weiter oben
schon beschrieben, dieselelektrische Antriebe bekamen. Heutzutage
nutzen moderne Schiffsantriebe das schon damals von Verne beschriebene
Prinzip der Entkopplung von Energieerzeugung und Schiffsantrieb.
Dieselgeneratoren erzeugen in sogenannten Maschinen-Generator-Sätzen
Strom, der dann durch den Einsatz von Umrichtern mit einer eleganten
Drehzahlregelung den elektrischen Antrieb ermöglicht. Eine schnelle
Trennung oder Abschaltung der Schiffsschraube/n ist dadurch ebenfalls
möglich.
Aber nicht immer wird von Jules
Verne alles und jedes Detail beschrieben. Eleganter und unverfänglicher
ist es, wenn man nur die Wirkungen und den eventuellen Ursprung der
Antriebskraft beschreibt, so wir wir es schon weiter oben bei den
Schnellbooten >Electric< und dem U-Boot Ker Karrajes
gelesen haben. Damit kann man allen praktischen Detaildiskussionen der
Ausführbarkeit den Wind aus den Segeln nehmen. So geschehen erneut in
den Robur-Romanen. So setzt Verne im 1886 erschienenen
Buch  Robur
der Eroberer auch wieder
auf den Elektroantrieb, beschreibt diesen aber nur sehr verschwommen.
So können wir lesen: „Die zum Vortrieb und um den Apparat in der
Luft zu halten nötige Kraft bezog Robur weder vom Wasserdampf noch aus
komprimierter Luft oder anderen Gasen, auch nicht aus Explosivstoffen,
die ihm die nötige mechanische Wirkung erzeugten, sondern aus der
Elektrizität. Übrigens hatte er keinerlei Elektromotore an Bord seines
Flugapparates, sondern weiter nichts als Säuren und Akkumulatoren.“/5/
Zwischenbemerkung von mir: Hier hat sich in der deutschen Übersetzung
offensichtlich ein Fehler eingeschlichen. Gemeint ist sicher das Fehlen
von Dynamomaschinen zum Erzeugen der Energie, denn Motore werden zum
rotatorischem Antrieb der vielen Luftschrauben benötigt. Aber weiter im
Text. „Aber wie sich diese Säuren zusammensetzten,
das war Roburs Geheimnis, genauso wie die Arbeitsweise der
Akkumulatoren.“ ... „Nur
eins stand fest: Seine Batterien waren von außergewöhnlich hohem
Wirkungsgrad, seine Säuren von fast absoluter Widerstandskraft gegen
verdunsten oder Gefrieren, und seine Akkumulatoren lieferten ihm einen
Strom wie keine anderen je zuvor.“/5/ Robur
der Eroberer auch wieder
auf den Elektroantrieb, beschreibt diesen aber nur sehr verschwommen.
So können wir lesen: „Die zum Vortrieb und um den Apparat in der
Luft zu halten nötige Kraft bezog Robur weder vom Wasserdampf noch aus
komprimierter Luft oder anderen Gasen, auch nicht aus Explosivstoffen,
die ihm die nötige mechanische Wirkung erzeugten, sondern aus der
Elektrizität. Übrigens hatte er keinerlei Elektromotore an Bord seines
Flugapparates, sondern weiter nichts als Säuren und Akkumulatoren.“/5/
Zwischenbemerkung von mir: Hier hat sich in der deutschen Übersetzung
offensichtlich ein Fehler eingeschlichen. Gemeint ist sicher das Fehlen
von Dynamomaschinen zum Erzeugen der Energie, denn Motore werden zum
rotatorischem Antrieb der vielen Luftschrauben benötigt. Aber weiter im
Text. „Aber wie sich diese Säuren zusammensetzten,
das war Roburs Geheimnis, genauso wie die Arbeitsweise der
Akkumulatoren.“ ... „Nur
eins stand fest: Seine Batterien waren von außergewöhnlich hohem
Wirkungsgrad, seine Säuren von fast absoluter Widerstandskraft gegen
verdunsten oder Gefrieren, und seine Akkumulatoren lieferten ihm einen
Strom wie keine anderen je zuvor.“/5/ Ähnlich verhält es sich bei der
„Epouvante“, dem universellen und amphiben Fahrzeug von Robur, im 1904
veröffentlichten Buch  Der
Herr der Welt. Als dieser
mit überhöhter Geschwindigkeit in den nordamerikanischen Straßen
gesichtet wird, wird das Ereignis wie folgt beschrieben: „Auf
die Natur des Motors fehlte es an jedem Hinweis. Gewiss war nur, und es
wurde von allen Leuten bestätigt, dass dieser keinen Rauch, kein Dampf,
ebenso aber auch keinen Geruch nach Petroleum oder einem anderen
Mineralöl hinterließ. Man schloss daher, dass es sich um einen durch
Elektrizität angetriebenen Apparat handelte, dessen in unbekannter
Bauart hergestellte Batterien einen fast unerschöpflichen Strom
abzugeben schienen.“ /6/ Doch selbst der
clevere Strock, der sich an Bord des Amphibienfahrzeuges einschmuggelt,
kann den Antrieb nicht ergründen. Seine Version ist eine zentrale
Dynamoanlage im Innern der Stützpunkts Roburs, durch die er die
leistungsfähigen Batterien der „Epouvante“ auflädt. Interessant an
dieser Stelle: Während überall Automobile mit Verbrennungsmotor ihren
Siegeszug antraten, setzt Verne wieder auf seine geliebte Elektrizität.
Ihr traute er alle Leistungen zu. Der
Herr der Welt. Als dieser
mit überhöhter Geschwindigkeit in den nordamerikanischen Straßen
gesichtet wird, wird das Ereignis wie folgt beschrieben: „Auf
die Natur des Motors fehlte es an jedem Hinweis. Gewiss war nur, und es
wurde von allen Leuten bestätigt, dass dieser keinen Rauch, kein Dampf,
ebenso aber auch keinen Geruch nach Petroleum oder einem anderen
Mineralöl hinterließ. Man schloss daher, dass es sich um einen durch
Elektrizität angetriebenen Apparat handelte, dessen in unbekannter
Bauart hergestellte Batterien einen fast unerschöpflichen Strom
abzugeben schienen.“ /6/ Doch selbst der
clevere Strock, der sich an Bord des Amphibienfahrzeuges einschmuggelt,
kann den Antrieb nicht ergründen. Seine Version ist eine zentrale
Dynamoanlage im Innern der Stützpunkts Roburs, durch die er die
leistungsfähigen Batterien der „Epouvante“ auflädt. Interessant an
dieser Stelle: Während überall Automobile mit Verbrennungsmotor ihren
Siegeszug antraten, setzt Verne wieder auf seine geliebte Elektrizität.
Ihr traute er alle Leistungen zu. Heute
profitieren wir wie selbstverständlich in allen Bereichen des Lebens
von der „Electrizität“. Dabei sollten wir uns als Leser der Werke
Vernes bewusst werden, welch eines Glaubens an den technischen
Fortschritts es bedurfte, um diese breitenwirksame Umsetzung schon im
19. Jahrhundert zu erkennen. |