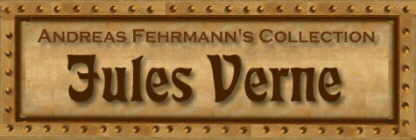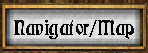|
Jules Verne Zitate sind wie gewohnt in blau dargestellt.
Quellenangaben,
und vielleicht der Reiz etwas mehr darüber zu lesen? (Die
Systematisierung bezieht sich nur auf die Nutzung für diesen Beitrag)
/1/ Jules Verne: Paris im 20. Jahrhundert ©
Paul Zsolnay Verlag, Wien 1996, ISBN 3-552-04804-9; Zitat von Seite
144; CF /6401/
/2/ Jules Verne: Eine schwimmende Stadt
; 1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN:
3-8224-1019-5 Pawlaks Collection Jules Verne Band 19; Zitat von Seite
119/120; CF /0801/
/3/ Jules Verne: Eine ideale Stadt; Chroniken
der Science-Fiction-Gruppe Hannover (SFGH); CHRONIK 199 – September
2002; Herausgeber/Redaktion: Wolfgang Thadewald. Übersetzung von Volker
Dehs, Deutsche Erstveröffentlichung. Zitat von Seite 61; CF /K1901/
/4/ Jules Verne: Der Kurier des Zaren;
1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1023-3
Pawlaks Collection Jules Verne Band 23 (2. Band vom „Zaren“); Zitat von
Seite 15; CF /1406/
/5/ Jules Verne: Ein Drama in den Lüften,
Lizenzausgabe des Deutschen Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart
München mit Genehmigung der Diogenes Verlag AG, Zürich; © 1967 by
Diogenes Verlag AG, Zürich; Die deutsche Ausgabe erschien im Diogenes
Verlag unter dem Titel „Der ewige Adam ...“; Bücherbundnummer: -05290/2
– Zitat von Seite 183; CF /K0401/
/6/ ebenda, Seite 184
/7/ ebenda, Seite 190
/8/ Jules Verne: Ein Lotterie-Los;
1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1052-7
Pawlaks Collection Jules Verne Band 52; Zitat von Seite 90; CF /2901/
/9/ ebenda Seite 94
/10/ gleiche Quelle wie /5/; Zitat von Seite 23
/11/ Volker Dehs: Jules Verne Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH 1986; Seite
112, Detailangaben siehe  Quelle CF /5501/ Quelle CF /5501/ /12/ Jules Verne: Der Findling;
1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN:
3-8224-1064-0 Pawlaks Collection Jules Verne Band 64 (1. Teil des
Findlings); Zitat von Seite 30; CF /3901/
/13/ Jules Verne: Clovis Dardentor;
1984 Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1071-3
Pawlaks Collection Jules Verne Band 71; Zitat von Seite 26; CF /4301/
/14/ ebenda, Seite 51
/15/ Jules Verne: Das Testament eines
Exzentrischen; 1984 Pawlak Taschenbuchverlag,
Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1076-4 Pawlaks Collection Jules Verne
Band 76 (1. Teil des Findlings); Zitat von Seite 21; CF /4601/
/16/ Jules Verne: Das Dorf in den Lüften; 1984
Pawlak Taschenbuchverlag, Berlin, Herrsching. ISBN: 3-8224-1080-2
Pawlaks Collection Jules Verne Band 80; Zitat von Seite 212; CF /4801/
Bildmaterial:
/17/
Bild: Florence
Nightingale (1820-1910) als Krankenpflegerin 1854/55 aus:
Heinz Goerke: „Arzt und Heilkunde“ Callwey München 1984; ISBN
3-7667-0728-0; Bildzitat von S. 240
/18/
Aus einer alten Hetzelausgabe von Matthias Sandorf: Sarah im Krankenbett
/19/
Jules Verne: Ein
Drama in den Lüften, Lizenzausgabe des Deutschen
Bücherbundes GmbH & Co Stuttgart München Bücherbundnummer:
-05290/2 – Bild /19/ ist aus diesem Buch. (Original von George Roux); CF
/K0401/
/20/
Jean Jules-Verne: Jules
Verne 1973; Bildzitat von Seite 199, Detailangaben siehe  Quelle
/5510/ Quelle
/5510/
|
Manche
Dinge nimmt man beim Lesen recht unbewusst war, vielleicht wird man
stutzig wenn man sie in einem weiteren Roman wieder angesprochen sieht,
aber irgendwann reift der Gedanke: Es scheint mehr als ein
stilistisches Mittel zu sein. So ging es mir, als ich ironische Worte
und ziemlich deutliche Kritik an Ärzten und deren Heilmethoden an
verschiedenen Stellen in Vernes Gesamtwerk fand. Als ich dann an seine
ständigen gesundheitlichen Probleme dachte, habe ich mir bestimmte
Dinge zusammengereimt. So habe ich nachfolgend einige Zitate,
eigentlich deutliche Spitzen in Richtung Ärzteschaft, ausgewählt und
mit den damaligen Gesundheitszustand Vernes, soweit ich diesen aus den
Werken seiner Biographen erkennen konnte, in Zusammenhang gebracht. Bei
der nachfolgenden Nennung der jeweiligen Erstausgaben ist zu beachten,
dass die eigentliche Entstehung eines Romans noch davor liegt, es ist
also ein Zeitversatz bei der Betrachtung zu beachten.
Schon während seines
Studiums in Paris (1848 bis 1851) hatte er mit seiner Gesundheit
Probleme. So plagten ihn ständige Magenbeschwerden, von denen er
annahm, dass er sie von seiner Mutter geerbt hatte. Dadurch musste er
eine ausgewählte und gezielte Kost zu sich nehmen, was seine Mittel
zusätzlich belastete. In seinem damals unveröffentlichten Roman  Paris
im 20. Jahrhundert schrieb er 1863, als er die
Zustände im zukünftigen Paris beschrieb: „Was
tun? Das ist immer die Frage, außer man ist Arzt, wenn man mit
Industrie, Handel und Finanz nichts zu schaffen haben will! Und selbst
dann, der Teufel soll mich holen! Ich glaube, die Krankheiten
nutzen sich ab, und wenn die Fakultät keine neuen züchtet, dann steht
sie bald ohne Arbeit da!“/1/ Paris
im 20. Jahrhundert schrieb er 1863, als er die
Zustände im zukünftigen Paris beschrieb: „Was
tun? Das ist immer die Frage, außer man ist Arzt, wenn man mit
Industrie, Handel und Finanz nichts zu schaffen haben will! Und selbst
dann, der Teufel soll mich holen! Ich glaube, die Krankheiten
nutzen sich ab, und wenn die Fakultät keine neuen züchtet, dann steht
sie bald ohne Arbeit da!“/1/
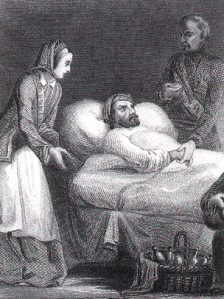 Dies ist
aus meiner Sicht das erste Zitat, in welchem er versucht, den kausalen
Zusammenhang zwischen Ärzteschaft und Krankheiten darzustellen. Hatte
er dazu Veranlassung? Es ist der Beginn einer ganzen Reihe ähnlich
gelagerter Aussagen. Aus diesen habe ich eine gewisse Unzufriedenheit
mit sich und dem von ihm nicht beeinflussbaren Schicksal in
gesundheitlichen Fragen herausgelesen. Dies ist
aus meiner Sicht das erste Zitat, in welchem er versucht, den kausalen
Zusammenhang zwischen Ärzteschaft und Krankheiten darzustellen. Hatte
er dazu Veranlassung? Es ist der Beginn einer ganzen Reihe ähnlich
gelagerter Aussagen. Aus diesen habe ich eine gewisse Unzufriedenheit
mit sich und dem von ihm nicht beeinflussbaren Schicksal in
gesundheitlichen Fragen herausgelesen.
Im
Jahre 1864, Jules verbringt gerade einige Zeit bei seinen Eltern in
Nantes, wird er unangenehm von einem neuen Übel heimgesucht: Eine
Lähmung der Gesichtsnerven stellt sich zum wiederholtem Male ein. Dabei
kommt es zu einer Entstellung des Gesichtes, denn eine Gesichtshälfte
ist wie tot. Einher geht dies mit einer zeitweiligen Beeinträchtigung
der Koordinierung der Augen. Von der Lähmung kann er sich nicht mehr
vollständig befreien. Sie ist mit ein Grund dafür, das sich Jules Verne
nach diesem Schicksalsschlag einen üppigen Vollbart wachsen ließ. So
verwundert es nicht, dass sich seine Meinung zur Medizin im allgemeinen
nach dem Erlebten nicht besserte. In einen seiner jetzt regelmäßig
verlegten Romane wird eine zufällige Heilung durch Naturkräfte als
wahrscheinlicher dargestellt, als die Chancen die durch eine
medizinische Maßnahme erreicht werden können. (Bild im Text: /17/)
Ende der 60er Jahre
des
19. Jahrhunderts schrieb er den Roman  Eine
schwimmende Stadt, der als Vorabveröffentlichung im
Zeitraum vom August bis zum September 1870 in "Journal des Débats
politiques et littéraires" und dann 1871 in Buchform veröffentlicht
wurde. Darin können wir lesen, als das Gespräch auf die Angst vor Blitz
und Donner kam: (... Angst ...) „>Ich?<
sagte der Doktor lebhaft; >der Donner ist sogar mein Freund, und
mehr als das, mein Arzt!< >Ihr Arzt?<
>Gewiß ist er das! So wie ich hier vor Ihnen stehe, bin ich am
13. Juli 1867 in Kiew bei London vom Blitz getroffen und dadurch von
einer Lähmung des rechten Arms geheilt worden, die aller Anstrengungen
der Ärzte spottete.< >Der Herr Doktor belieben zu
scherzen.< >Durchaus nicht! es ist das eine ökonomische
Behandlung, eine Behandlung mittelst Elektrizität. Es lassen sich noch
ganz andere authentische Tatsachen dafür anführen, mein lieber Herr, daß
der Donner klüger ist, als die geschicktesten Doktoren, und
seine Intervention gerade in den verzweifeltsten Fällen oft wunderbar
wirkt.<“ /2/ Eine
schwimmende Stadt, der als Vorabveröffentlichung im
Zeitraum vom August bis zum September 1870 in "Journal des Débats
politiques et littéraires" und dann 1871 in Buchform veröffentlicht
wurde. Darin können wir lesen, als das Gespräch auf die Angst vor Blitz
und Donner kam: (... Angst ...) „>Ich?<
sagte der Doktor lebhaft; >der Donner ist sogar mein Freund, und
mehr als das, mein Arzt!< >Ihr Arzt?<
>Gewiß ist er das! So wie ich hier vor Ihnen stehe, bin ich am
13. Juli 1867 in Kiew bei London vom Blitz getroffen und dadurch von
einer Lähmung des rechten Arms geheilt worden, die aller Anstrengungen
der Ärzte spottete.< >Der Herr Doktor belieben zu
scherzen.< >Durchaus nicht! es ist das eine ökonomische
Behandlung, eine Behandlung mittelst Elektrizität. Es lassen sich noch
ganz andere authentische Tatsachen dafür anführen, mein lieber Herr, daß
der Donner klüger ist, als die geschicktesten Doktoren, und
seine Intervention gerade in den verzweifeltsten Fällen oft wunderbar
wirkt.<“ /2/
 (Bild rechts: /18/) Aber es kommt noch
deutlicher. Die nachfolgende Textpassage war der eigentliche Initiator
dieses Beitrages von mir. Denn in seiner Kurzgeschichte (Bild rechts: /18/) Aber es kommt noch
deutlicher. Die nachfolgende Textpassage war der eigentliche Initiator
dieses Beitrages von mir. Denn in seiner Kurzgeschichte  Eine
ideale Stadt, die
unter dem Titel: „Une ville idéale“ am 13. / 14. Dezember 1875 im
„Journal d'Amiens“ erstmalig erschien, schrieb er diesen ironischen
Seitenhieb, der mit einer Aussage eines Arztes begann:
„>Schließlich
ist es nicht mehr wie zu Zeiten des Doktor Lenoël und seiner gelehrten
Zeitgenossen, Alexandre, Richer, Herbet, Peulevé, Faucon und wie sie
alle heißen - tadellose Mediziner, ganz gewiss ... Aber schließlich
haben wir doch gewisse Fortschritte gemacht! ...<“ /3/ Worauf der fiktiv in die Zukunft gereiste
Jules Verne antwortete: „>Ach<,
entfuhr es mir, >gewisse Fortschritte! ... Heilen Sie etwa jetzt
Ihre Kranken?<“
/3/. Etwas weiter findet sich dann diese
Textstelle, die vielleicht auch als Anregung unseres heutigen
Gesundheitssystems dienen könnte: „>Unsere
Klienten bezahlen uns nur, solange es ihnen gut geht. Fühlen sie sich
schlecht, bleibt die Kasse zu! Auf diese Weise haben wir kein Interesse
mehr daran, dass sie jemals krank werden. Deshalb gibt es keine
Epidemien mehr, oder so gut wie keine! Allerorten blühendes
Wohlbefinden, das wir hegen und pflegen, wie ein Pächter seinen
Gutsbetrieb in Schuss hält! Krankheiten - bei unserem neuen System
würden sie die Ärzte in den Ruin treiben, und diese machen ganz im
Gegenteil ein gutes Geschäft.<“ /3/ Eine
ideale Stadt, die
unter dem Titel: „Une ville idéale“ am 13. / 14. Dezember 1875 im
„Journal d'Amiens“ erstmalig erschien, schrieb er diesen ironischen
Seitenhieb, der mit einer Aussage eines Arztes begann:
„>Schließlich
ist es nicht mehr wie zu Zeiten des Doktor Lenoël und seiner gelehrten
Zeitgenossen, Alexandre, Richer, Herbet, Peulevé, Faucon und wie sie
alle heißen - tadellose Mediziner, ganz gewiss ... Aber schließlich
haben wir doch gewisse Fortschritte gemacht! ...<“ /3/ Worauf der fiktiv in die Zukunft gereiste
Jules Verne antwortete: „>Ach<,
entfuhr es mir, >gewisse Fortschritte! ... Heilen Sie etwa jetzt
Ihre Kranken?<“
/3/. Etwas weiter findet sich dann diese
Textstelle, die vielleicht auch als Anregung unseres heutigen
Gesundheitssystems dienen könnte: „>Unsere
Klienten bezahlen uns nur, solange es ihnen gut geht. Fühlen sie sich
schlecht, bleibt die Kasse zu! Auf diese Weise haben wir kein Interesse
mehr daran, dass sie jemals krank werden. Deshalb gibt es keine
Epidemien mehr, oder so gut wie keine! Allerorten blühendes
Wohlbefinden, das wir hegen und pflegen, wie ein Pächter seinen
Gutsbetrieb in Schuss hält! Krankheiten - bei unserem neuen System
würden sie die Ärzte in den Ruin treiben, und diese machen ganz im
Gegenteil ein gutes Geschäft.<“ /3/
Sein herauszulesender
Frust geht soweit, dass er sogar Anspielungen auf die Fachkundigkeit
der Ärzte macht. 1876 konnte man im  Kurier
des Zaren Kurier
des Zaren les en:
„>Ich behandle
Sie mit Wasser<, sagte er. >Diese Flüssigkeit ist das
wirksamste Sedativum, das man bei der Behandlung von Verwundungen kennt
und wird jetzt auch ganz allgemein angewendet. Die Ärzte
haben nur 6000 Jahre gebraucht, um das zu entdecken! Ja, in
runder Zahl so gegen 6000 Jahre!<“ /4/ 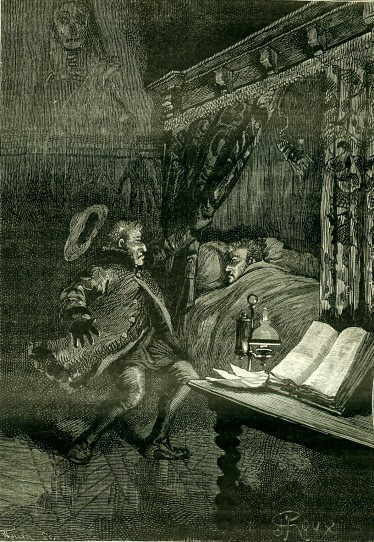 Die
bissigste Satire zu diesem Themenkreis schrieb er in der Kurzgeschichte Die
bissigste Satire zu diesem Themenkreis schrieb er in der Kurzgeschichte
 Frritt-Flacc,
auch Der Sturm Sie wurde 1884 bis 1885
unter dem Titel: „Frritt-Flacc“ in „Le Figaro illustré“ (Paris)
erstveröffentlicht, im Folgejahr kam dann die Veröffentlichung in
Buchform. In der Geschichte wird die Hauptperson so beschrieben: „Ein harter Mann, dieser Dr. Trifulgas, ein
mitleidloser Mann; Patienten nimmt er nur gegen Vorausbezahlung an.
Sein Hund heißt Hurzof, er ..... dürfte mehr Herz haben als sein Herr.“
/5/ Diese Einschätzung verwundert nicht, hat er doch einen speziellen
Arbeitsstil und eine etwas „ungewöhnliche“ Einstellung zu seiner
Berufsethik : „>Ein
Schlaganfall? Das macht zweihundert Fretzer!< (die
dortige Währung – Anmerkung A.F.) stellt
Dr. Trifulgas hartherzig fest. >Wir haben aber bloß
hundertundzwanzig!< >Dann gute Nacht!< Wieder wird
das Fenster zugeschlagen.“ /6/ Doch das Schicksal wird ihn
für seine Hartherzigkeit bestrafen!
Der Doktor wird zu einem Patienten gerufen, der mystischer Weise er
selbst ist (siehe dazu Bild rechts /19/). Ungeachtet aller Versuche
stirbt er unter seinen eigenen Händen! Und so endet die Geschichte: „Am folgenden Morgen fand man im Hause ....
nur noch eine Leiche vor – die Leiche von Dr. Trifulgas. Er wurde in
einen Sarg gelegt und mit großen Prunk auf den Friedhof von Luktrop
beigesetzt, nachdem er so viele andere Mitbürger dorthin gebracht hatte
– ganz genau nach Rezept ...“ /7/ Frritt-Flacc,
auch Der Sturm Sie wurde 1884 bis 1885
unter dem Titel: „Frritt-Flacc“ in „Le Figaro illustré“ (Paris)
erstveröffentlicht, im Folgejahr kam dann die Veröffentlichung in
Buchform. In der Geschichte wird die Hauptperson so beschrieben: „Ein harter Mann, dieser Dr. Trifulgas, ein
mitleidloser Mann; Patienten nimmt er nur gegen Vorausbezahlung an.
Sein Hund heißt Hurzof, er ..... dürfte mehr Herz haben als sein Herr.“
/5/ Diese Einschätzung verwundert nicht, hat er doch einen speziellen
Arbeitsstil und eine etwas „ungewöhnliche“ Einstellung zu seiner
Berufsethik : „>Ein
Schlaganfall? Das macht zweihundert Fretzer!< (die
dortige Währung – Anmerkung A.F.) stellt
Dr. Trifulgas hartherzig fest. >Wir haben aber bloß
hundertundzwanzig!< >Dann gute Nacht!< Wieder wird
das Fenster zugeschlagen.“ /6/ Doch das Schicksal wird ihn
für seine Hartherzigkeit bestrafen!
Der Doktor wird zu einem Patienten gerufen, der mystischer Weise er
selbst ist (siehe dazu Bild rechts /19/). Ungeachtet aller Versuche
stirbt er unter seinen eigenen Händen! Und so endet die Geschichte: „Am folgenden Morgen fand man im Hause ....
nur noch eine Leiche vor – die Leiche von Dr. Trifulgas. Er wurde in
einen Sarg gelegt und mit großen Prunk auf den Friedhof von Luktrop
beigesetzt, nachdem er so viele andere Mitbürger dorthin gebracht hatte
– ganz genau nach Rezept ...“ /7/
In der gleichen Zeit
schrieb er den Roman  Ein
Lotterielos, der 1886 erstveröffentlicht wurde.
Dort können wir lesen: „>Herr Sylvius<, begann da
Hulda, >wünschen Sie vielleicht, daß mein Bruder von Bamble
einen Arzt herbeiholt?< > Einen Arzt, meine kleine Hulda?
Aber wollt Ihr denn, daß ich gar den Gebrauch meiner beiden Beine
einbüße?<“ /8/ Etwas
weiter wird sogar mit einem Arzt „gedroht“, aber das ist recht scherzhaft gemeint: „>Wie
Sie wünschen, Herr Sylvius<, antwortete Hulda, >begehen
Sie aber keine neue Unvorsichtigkeit, sonst müßte Joel doch noch den
Arzt herbeiholen.< >Was? Drohungen?... Nun ja, ich werde
schon vernünftig und ganz artig sein; und so lange ich nicht auf zu
knappe Diät gesetzt bin, sollt Ihr an mir den folgsamsten Patienten
haben.<“ /9/ Ein
Lotterielos, der 1886 erstveröffentlicht wurde.
Dort können wir lesen: „>Herr Sylvius<, begann da
Hulda, >wünschen Sie vielleicht, daß mein Bruder von Bamble
einen Arzt herbeiholt?< > Einen Arzt, meine kleine Hulda?
Aber wollt Ihr denn, daß ich gar den Gebrauch meiner beiden Beine
einbüße?<“ /8/ Etwas
weiter wird sogar mit einem Arzt „gedroht“, aber das ist recht scherzhaft gemeint: „>Wie
Sie wünschen, Herr Sylvius<, antwortete Hulda, >begehen
Sie aber keine neue Unvorsichtigkeit, sonst müßte Joel doch noch den
Arzt herbeiholen.< >Was? Drohungen?... Nun ja, ich werde
schon vernünftig und ganz artig sein; und so lange ich nicht auf zu
knappe Diät gesetzt bin, sollt Ihr an mir den folgsamsten Patienten
haben.<“ /9/
Für Jules Verne
begann
jetzt eine Zeit, die zu den schwärzeren Kapiteln in seinem Leben zählt.
1887 stirbt seine Mutter in Nantes, und er selbst ist schwer krank. Aus
diesem Grunde kann er erst nach ihrer Beerdigung die Reise nach Nantes
zur Erledigung der Erbschaftsangelegenheiten antreten. Kontinuierlich
nehmen seine gesundheitlichen Probleme zu. In der in dieser Zeit
geschriebenen Kurzgeschichte  Ein
Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889,
dessen Erstausgabe im Februar 1889 in der amerikanischen Zeitschrift
„The Forum“ (New York) erschien und welche am 21. Januar 1891 mit
einigen Änderungen in französischer Sprache unter dem Titel: „La
journée d'un journaliste américain en 2889“ im „Journal d'Amiens.
Monituer de la Somme“ gedruckt wurde, fand ich eine Textpassage, die
von bahnbrechenden Ideen in der Zukunft berichtete: „... Und schließlich (meldete sich) der Arzt, der kühn behauptet, er habe ein
todsicheres Rezept gegen Schnupfen ... All diese Phantasten werden
natürlich prompt vor die Tür gesetzt.“ /10/ Bei dieser Audienz beim Medienmogul und
der Vorstellung dieser Neuerung wurde der Arzt glatt
abgewiesen. Sogar die Bekämpfung eines Schnupfens schien Verne selbst
in der Zukunft als unrealistisch anzusehen. Leider konnte ich nicht in
Erfahrung bringen, ob die verwendete Wortwahl die Eingebung des
Übersetzers war, oder ob sie der spitzen Feder Vernes wirklich
entsprang. Denn ein „todsicheres Rezept“ sollte kein Arzt verschreiben
.... (siehe dazu ganz unten /21/ als Ergänzung
dieser These). Ein
Tag aus dem Leben eines amerikanischen Journalisten im Jahre 2889,
dessen Erstausgabe im Februar 1889 in der amerikanischen Zeitschrift
„The Forum“ (New York) erschien und welche am 21. Januar 1891 mit
einigen Änderungen in französischer Sprache unter dem Titel: „La
journée d'un journaliste américain en 2889“ im „Journal d'Amiens.
Monituer de la Somme“ gedruckt wurde, fand ich eine Textpassage, die
von bahnbrechenden Ideen in der Zukunft berichtete: „... Und schließlich (meldete sich) der Arzt, der kühn behauptet, er habe ein
todsicheres Rezept gegen Schnupfen ... All diese Phantasten werden
natürlich prompt vor die Tür gesetzt.“ /10/ Bei dieser Audienz beim Medienmogul und
der Vorstellung dieser Neuerung wurde der Arzt glatt
abgewiesen. Sogar die Bekämpfung eines Schnupfens schien Verne selbst
in der Zukunft als unrealistisch anzusehen. Leider konnte ich nicht in
Erfahrung bringen, ob die verwendete Wortwahl die Eingebung des
Übersetzers war, oder ob sie der spitzen Feder Vernes wirklich
entsprang. Denn ein „todsicheres Rezept“ sollte kein Arzt verschreiben
.... (siehe dazu ganz unten /21/ als Ergänzung
dieser These).
Aber
Jules Vernes Gesundheitszustand bessert sich nicht mehr. „Jules Verne
mag nicht mehr reisen, und kann es auch nicht mehr: Rheumatismus und
Gicht bereiten ihm große Schmerzen. Die größten Sorgen bereitet der
Magen: Verne wird auf Diät gesetzt und darf nichts als Gemüse essen,
dann nur noch Eier- und Milchgerichte, was ihn weiter schwächt.
Magenspülungen bleiben erfolglos; die Ärzte vermuten eine
Magenerweiterung, zu spät wird man erkennen, daß Diabetes die Ursache
ist.“ /11/ schreibt Volker Dehs. Dazu kam, dass er nach dem Attentat
Gastons 1886 nie wieder schmerzfrei gehen konnte.
Vielleicht ist dies
der
Grund, dass das jetzt folgende Zitat noch sarkastischer als die bereits
vorgestellten Passagen klingt. Der folgende Wortwechsel zwischen einem
Arzt und dem Leiter eines Kinderheims im Roman  Der
Findling von 1893 klingt so: „> Na, und wenn sie (die im Heim befindlichen Kinder – Anmerkung
A.F.) ihrer Krankheit erliegen<,
unterbrach ihn der Doktor, schon nach Hut und Stock fassend, >ist
der Verlust, mein' ich, auch nicht so arg....<
>Gewiß nicht<, stimmte O'Bodkins zu. >Ich schreibe
sie dann in die Rubrik der Verstorbenen ein und ihr Konto wird
abgeschlossen. Ist das aber geschehen, so hat niemand mehr Ursache sich
zu beklagen<. Mit einem Händedruck verabschiedete sich der Arzt
des Hauses.“ /12/ Der
Findling von 1893 klingt so: „> Na, und wenn sie (die im Heim befindlichen Kinder – Anmerkung
A.F.) ihrer Krankheit erliegen<,
unterbrach ihn der Doktor, schon nach Hut und Stock fassend, >ist
der Verlust, mein' ich, auch nicht so arg....<
>Gewiß nicht<, stimmte O'Bodkins zu. >Ich schreibe
sie dann in die Rubrik der Verstorbenen ein und ihr Konto wird
abgeschlossen. Ist das aber geschehen, so hat niemand mehr Ursache sich
zu beklagen<. Mit einem Händedruck verabschiedete sich der Arzt
des Hauses.“ /12/
Dagegen klingt ja das
nachfolgende Zitat aus  Clovis
Dardentor (in Buchform 1896) richtig harmlos, wenn
nur die Neugier des Berufsstandes ein Thema ist: „>Oh, meine Herren<,
entschuldigte sich der Doktor Bruno, >meine Fragen mögen wohl
indiskret erscheinen. Doch das beruht auf meiner Tätigkeit... ein Arzt
muß alles wissen, selbst das, was ihn gar nichts angeht. Sie verzeihen
also... <“ /13/ Aber
sein Ton wird im gleichen Roman wieder schärfer, als er seinen Helden
folgende Worte in den Mund legte: „>Am
letzten Ende<, fuhr der Doktor fort, >mein' ich, Sie
werden doch einmal sterben.< >Warum soll ich
denn sterben, da ich doch niemals einen Arzt konsultiert habe?...
Ihr Wohlsein, meine Herrn!<“
/14/ Und da war sie wieder, die Anspielung von „Arzt“ und
„Tod“. Clovis
Dardentor (in Buchform 1896) richtig harmlos, wenn
nur die Neugier des Berufsstandes ein Thema ist: „>Oh, meine Herren<,
entschuldigte sich der Doktor Bruno, >meine Fragen mögen wohl
indiskret erscheinen. Doch das beruht auf meiner Tätigkeit... ein Arzt
muß alles wissen, selbst das, was ihn gar nichts angeht. Sie verzeihen
also... <“ /13/ Aber
sein Ton wird im gleichen Roman wieder schärfer, als er seinen Helden
folgende Worte in den Mund legte: „>Am
letzten Ende<, fuhr der Doktor fort, >mein' ich, Sie
werden doch einmal sterben.< >Warum soll ich
denn sterben, da ich doch niemals einen Arzt konsultiert habe?...
Ihr Wohlsein, meine Herrn!<“
/14/ Und da war sie wieder, die Anspielung von „Arzt“ und
„Tod“.
Aufgrund seines
schlechten gesundheitlichen Zustandes hatte sich Verne Mitte der 90er
Jahre vorgenommen, keine Reisen mehr anzutreten. Seine letzte
nachweisliche Reise trat er im Winter 1896/97 gezwungener Maßen nach
Paris an. Zeitgleich zu Papier gebracht, konnte man im Roman  Das
Testament eines Exzentrischen 1899 lesen, dass es
nur eine Frage der Anzahl der Ärzte ist, um die Bedrohung für Leib und
Leben zu erhöhen. Aber manchmal stirbt man eben auch ohne Arzt, so wie
hier geschehen: „Dieses prächtige
Musterbild eines Nordamerikaners erfreute sich einer eisernen
Gesundheit. Nie hatte ein Arzt ihm nach dem Puls gefühlt, nie einer
seine Zunge geprüft, ihm in den Hals gesehen, die Brust beklopft oder
das Herz behorcht, niemals war seine Körpertemperatur mittelst
Thermometers gemessen worden. Und an Ärzten fehlt es in Chicago gerade
nicht ... Man hätte also sagen können, daß eigentlich keine Maschine -
und wäre es eine von hundert Ärztekraft - im Stande gewesen wäre, ihn
aus dieser Welt zu reißen und in eine andere zu befördern; dennoch
war er nun gestorben, ohne Hilfe der medizinischen Fakultät -
und infolge dieser überraschenden Leistung stand eben sein Leichenwagen
jetzt vor dem Tore der Oakswoods Cemetry.“ /15/ Das
Testament eines Exzentrischen 1899 lesen, dass es
nur eine Frage der Anzahl der Ärzte ist, um die Bedrohung für Leib und
Leben zu erhöhen. Aber manchmal stirbt man eben auch ohne Arzt, so wie
hier geschehen: „Dieses prächtige
Musterbild eines Nordamerikaners erfreute sich einer eisernen
Gesundheit. Nie hatte ein Arzt ihm nach dem Puls gefühlt, nie einer
seine Zunge geprüft, ihm in den Hals gesehen, die Brust beklopft oder
das Herz behorcht, niemals war seine Körpertemperatur mittelst
Thermometers gemessen worden. Und an Ärzten fehlt es in Chicago gerade
nicht ... Man hätte also sagen können, daß eigentlich keine Maschine -
und wäre es eine von hundert Ärztekraft - im Stande gewesen wäre, ihn
aus dieser Welt zu reißen und in eine andere zu befördern; dennoch
war er nun gestorben, ohne Hilfe der medizinischen Fakultät -
und infolge dieser überraschenden Leistung stand eben sein Leichenwagen
jetzt vor dem Tore der Oakswoods Cemetry.“ /15/
In dem 1901
herausgegebenen Roman  Das
Dorf in den Lüften lässt er nochmals seine
Argumentationskette „Arzt“ - „Krankheit“ - „Tod“ aufleben. Obwohl schon
mit eigenen Worten als „unziemlich“ charakterisiert, muss er die
Bemerkung wohl trotzdem loswerden: „Hier
muß man also zugeben, daß, obwohl ein Arzt, den man sogar zum
König gemacht hatte, im Dorfe lebte, die Sterblichkeit nicht
zugenommen hatte. Eine etwas unziemliche Bemerkung über den
Ärztestand, die Max Huber aber doch nicht unterdrücken konnte.“ /16/ Das
Dorf in den Lüften lässt er nochmals seine
Argumentationskette „Arzt“ - „Krankheit“ - „Tod“ aufleben. Obwohl schon
mit eigenen Worten als „unziemlich“ charakterisiert, muss er die
Bemerkung wohl trotzdem loswerden: „Hier
muß man also zugeben, daß, obwohl ein Arzt, den man sogar zum
König gemacht hatte, im Dorfe lebte, die Sterblichkeit nicht
zugenommen hatte. Eine etwas unziemliche Bemerkung über den
Ärztestand, die Max Huber aber doch nicht unterdrücken konnte.“ /16/
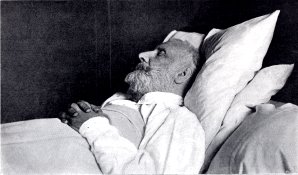 Schreibbesessen wie er ist, versuchte er der
Krankheit zu trotzen. Er hatte, wie oben bei seinem Biographen zitiert,
Probleme mit dem Magen, leidet schwer unter dem Grauen
Star - der ihm fast zur Erblindung führt - und dazu kommt auch noch ein
Schreibkrampf in der rechten Hand. Trotzdem versucht er bis zum Schluss
zu schreiben, auch wenn seine Texte immer schwerer lesbar werden. Nach
langem Leiden starb Jules Verne am 24.
März 1905 (siehe dazu Schreibbesessen wie er ist, versuchte er der
Krankheit zu trotzen. Er hatte, wie oben bei seinem Biographen zitiert,
Probleme mit dem Magen, leidet schwer unter dem Grauen
Star - der ihm fast zur Erblindung führt - und dazu kommt auch noch ein
Schreibkrampf in der rechten Hand. Trotzdem versucht er bis zum Schluss
zu schreiben, auch wenn seine Texte immer schwerer lesbar werden. Nach
langem Leiden starb Jules Verne am 24.
März 1905 (siehe dazu  Abschied
nehmen von Jules Verne). Bild links: Jules auf dem
Sterbebett /20/.
Abschied
nehmen von Jules Verne). Bild links: Jules auf dem
Sterbebett /20/.
NACHTRAG: Meine
Betrachtung birgt ein Risiko in sich. Denn alle Zitate beziehen sich
auf deutsche Übersetzungen. Aus diesem Grunde habe ich möglichst aus
dem Original nahe kommenden Quellen zitiert. Ich hoffe, dass die
Übersetzungen sachkundig erfolgten, nicht das der Sarkasmus ein
Stilmittel der Übersetzer war. Aber die Anzahl der gefundenen
Textstellen sollte meine Befürchtung relativieren ...
ERGÄNZUNG:
Zum
todsicheren Rezept
gegen Schnupfen in Ein Tag aus dem Leben eines amerikanischen
Journalisten... schrieb mir Bernhard Kraut am 22.11.2005: Die
Originalformulierung aus dem Journalisten
nach der französischen Vorlage (Jahr 2890 und nicht
2889) lautet: „Et cet autre, plus audacieux, ne prétendait - il pas
qu'il possédait un remède spécifique contre le rhume du cerveau?...“
d.h.: „Und dieser andere, noch dreister, gab er nicht vor das er im
Besitz eines Wundermittels gegen den Schnupfen sei?...“ Leider habe ich die Version
aus Hier et
demain, auf der die deutsche Übersetzung beruht, und die
ja von Michel Verne modifiziert wurde, nicht vorliegen. Also Jules
Vernes Feder entspringt die spitze Bemerkung des "Todsicheren Rezeptes"
nicht, aber vielleicht die der von Michel?
NACH OBEN - SEITENANFANG
|